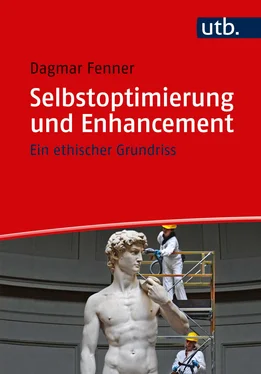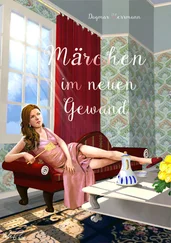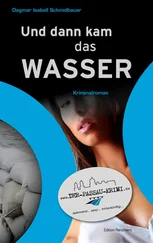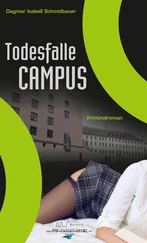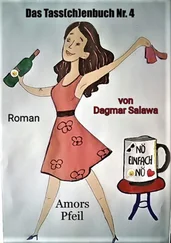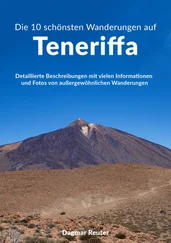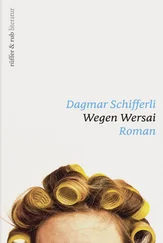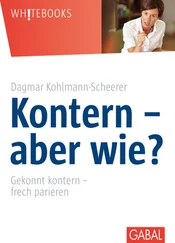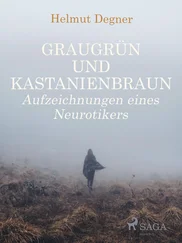Aufschlussreich für das Verständnis des Phänomens menschlicher Willensfreiheit ist die Unterscheidung zwischen einem „Wünschen“ und einem „Wollen“ bzw. zwischen „Wünschen“ und „Zielen“: Das Wollen setzt ein Können voraus und ist mehr als ein bloßes Sich-Wünschen. Typisch für den Willen ist es, dass er im Gegensatz zum bloßen Wünschen etwas in der Realität in Bewegung setzt und das Handeln lenkt. Der Wille einer Person kann sich daher immer nur auf die tatsächlich offenstehenden Handlungsmöglichkeiten beziehen, sodass die Möglichkeiten des Wollenkönnens durch die oben genannten Beschränkungen der Handlungsfreiheit limitiert sind: durch die natürliche und soziale Wirklichkeit, die wir immer schon vorfinden und nicht kurzfristig und grundlegend umgestalten können, und durch interne bzw. innere Anlagen und Fähigkeiten, über die man bereits verfügt und die man lediglich in bestimmten Grenzen optimieren kann (vgl. BieriBieri, Peter, 38f.; 50f.). Wünschen hingegen kann man sich buchstäblich alles, z.B. die Welt zu verändern oder als Opernsängerin in der Mailänder Scala aufzutreten. WünscheWünsche sind grundsätzlich idealitätsorientierte Vorstellungen eines befriedigenden Zustandes, FreiheitFreiheitWillens-, Autonomie (positive)die uns entweder das Gefühl der Fremdkontrolle oder des Getriebenseins vermitteln oder als realitätsfremde Phantasieprodukte sogar das Handeln lähmen (vgl. Fenner 2007, 60). Ganz anders verhält es sich mit realitätsorientierten ZielenZiele, die Gegenstand eines aktiven Wollens sind und mit der Erfahrung von Selbstkontrolle einhergehen. In der Motivationspsychologie wurde für den entscheidenden Übergang vom Wunsch zum Ziel bzw. vom Wünschen zum Wollen das „Rubikonmodell“ entwickelt und nach dem Fluss Rubikon benannt, den Cäsar 49 v.Chr. nach langem Abwägen überschritt und damit den Bürgerkrieg eröffnete (vgl. ebd./Rheinberg, 168f.): Entscheidend für das Überqueren des Rubikon ist der Prozess des Überlegens und Prüfens, ob sich die oft ganz spontan auftauchenden Wünsche unter den gegebenen Bedingungen überhaupt realisieren lassen und ob ihre Erfüllung keine negativen Konsequenzen mit sich bringen würde. Zudem muss sich die Person mit den Mitteln der Umsetzung eines Wunsches beschäftigen und geeignete Methoden und Schritte der Durchführung auswählen. Solange jemand nur den Wunsch hat, eine Chopinsonate zu spielen, braucht es keinen planenden Verstand. Wer sie aber wirklich spielen will, muss sich beispielsweise überlegen, wie er die Noten beschaffen kann und wann er Zeit zum Üben hat (vgl. BieriBieri, Peter, 37). Nur dann bleibt es nicht beim bloßen Gedankenspiel, sondern es entwickelt sich im Planungsprozess die Bereitschaft, die Schritte auch tatsächlich durchzuführen. Der Wunsch kann dann „handlungswirksam“ und damit ein „Wille“ werden, wie es in Harry Frankfurts Modell heißt (vgl. unten).
Erkenntnisbedingungen: hinlängliches Wissen und kognitive Fähigkeiten
FreiheitFreiheitWillens-, Autonomie (positive)Damit sich ein freier Wille bilden kann, müssen etwas konkreter folgende Erkenntnisbedingungenerfüllt sein: Zunächst braucht es ein hinlängliches Wissensowohl über die vorgefundene Wirklichkeit als auch die eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Jemand muss einigermaßen realistisch einschätzen können, welche Handlungsoptionen ihm zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich offenstehen. Da in verschiedenen Handlungssituationen jeweils ganz unterschiedliche Kenntnisse vonnöten sind, kann die Willensfreiheit einer Person situativ in größerem oder kleinerem Grad vorhanden sein: Jemand kann in hinreichendem Maß willensfrei sein bei alltäglichen Verrichtungen wie Einkaufen, aber unfrei bei komplexeren Betätigungsformen wie Bankgeschäften. Wenn die kognitiven Fähigkeiten des Wahrnehmens und Erkennensz.B. infolge einer psychischen Erkrankung eingeschränkt sind, kommt es zu einer inadäquaten Situationswahrnehmung wie etwa beim „Tunnel-Blick“ von Depressiven oder einer krankhaft veränderten Körperwahrnehmung bei Kandidatinnen für Schönheitsoperationen (Kap. 3.1). Willensfreiheit erfordert daher zusätzlich die kognitiven Fähigkeiten des kritischen Prüfens und Hinterfragens: Kritisch überprüft werden sollen die eigenen Wünsche und Hintergrundannahmen, auf denen sie basieren. Auszusondern sind zum einen „neurotische WünscheWünscheneurotische“, die einer krankhaften psychischen Verfassung wie der erwähnten Körperbild-Störung oder einem Minderwertigkeitskomplex entspringen (vgl. Fenner 2007, 68f.). Denn die Befriedigung solcher Wünsche etwa nach Schönheitsoperationen oder der Eroberung von Frauen zum Beweis der eigenen Unwiderstehlichkeit bringt nicht die erhoffte Erfahrung von Erfüllung. Zum andern dürfen „uninformierteWünscheinformierte/uninformierte“ oder „unaufgeklärteWünscheaufgeklärte/unaufgeklärte Wünsche“ nicht zu Handlungszielen mutieren, weil ihnen Fehleinschätzungen der Handlungssituation oder der eigenen Fähigkeiten zugrunde liegen (vgl. ebd., 62f.). Dazu zählt etwa der oben erwähnte Wunsch nach einem Auftritt in der Scala bei mittelmäßigem musikalischem Talent. Eine sorgfältige Prüfung der eigenen Wünsche setzt eine reflexive, distanzierte Grundhaltung zu den eigenen Einstellungen und einen inneren, kritischen Abstand zu sich selbst voraus (vgl. BieriBieri, Peter, 71f./LeefmannLeefmann, Jon, 287f.). Ruiniert wird eine solche Haltung durch heftige Affekte oder Triebe: Höchst unfrei ist jemand in einer sogenannten Affekthandlung, bei der ein kurzzeitiger intensiver Erregungszustand etwa aufgrund einer überfordernden Stresssituation oder einer akuten Existenzangst die Einsichts- und Kritikfähigkeit ausschaltet oder stark herabsetzt. Genauso unfrei sind triebhafte Menschen, die sich einfach von ihren unhinterfragten spontanen Wünschen treiben lassen (vgl. FrankfurtFrankfurt, Harry, 72f.).
Wertungsbedingung: Ausbildung von Wünschen zweiter Ordnung
FreiheitFreiheitWillens-, Autonomie (positive)Neben dieser Erkenntnisbedingung muss noch die Wertungsbedingungerfüllt sein: Die eigenen Dispositionen, Wünsche und Einstellungen sollen nicht nur erkannt, sondern auch mithilfe eigener Überlegungen bewertet werden (vgl. LeefmannLeefmann, Jon, 287). Willensfreiheit setzt nicht allein die Erkenntnis der faktisch vorhandenen Wünsche erster OrdnungWünscheerster/zweiter Ordnung voraus, die unmittelbar auf einen ersehnten Zustand oder ein erstrebtes Objekt gerichtet sind. Vielmehr braucht es gemäß Frankfurts vieldiskutierter Theorie der Willensfreiheit noch Wünsche zweiter Ordnung, die sich wertend auf solche Wünsche erster Ordnung beziehen (vgl. FrankfurtFrankfurt, Harry, 71): Wünsche zweiter Ordnungsind die auf einer höheren Reflexionsebene befindlichen Wünsche, bestimmte Wünsche erster Ordnung zu haben oder nicht zu haben. Wünscht sich jemand auf dieser höheren Ebene, dass ein bestimmter bereits vorhandener Wunsch ein Wille werde, nennt FrankfurtFrankfurt, Harry die entsprechenden Wünsche zweiter Ordnung Volitionen. Eine Person wäre genau dann willensfrei, wenn diejenigen Wünsche erster Ordnung handlungswirksam werden, die ihren Volitionen zweiter Ordnung entsprechen. Wichtig ist der Akt der Identifikation, d.h. die positive Bewertung und Bejahung der eigenen handlungswirksamen Wünsche und damit des eigenen Willens, weil dieser erst dadurch eine besondere „Zugehörigkeit“ zur Person erhält (vgl. BieriBieri, Peter, 382/FrankfurtFrankfurt, Harry, 93/KipkeKipke, Roland 2011, 106). Wünsche zweiter Ordnung können zentrale Wertvorstellungen, weiterreichende berufliche oder familiäre Lebensziele oder abstrakte Ideale wie Tapferkeit oder Coolness sein. Sie legen fest, was einer Person in ihrem Leben wichtig ist und wer sie sein möchte, und müssen sich mit vernünftigen Gründen rechtfertigen lassen. Während bei FrankfurtFrankfurt, Harry die Frage nach einem Bewertungsmaßstab für die Wünsche zweiter Ordnung offen bleibt und womöglich in einem unendlichen Regress auf immer noch höhere Stufen verschoben wird, hat man sein Modell später durch das Kriterium der „Kohärenz“ erweitert (vgl. KipkeKipke, Roland 2009, 377): Volitionen müssen kohärent sein, d.h. in den Gesamtzusammenhang einer Persönlichkeit mit stabilem Wertesystem und umfassendem Lebensplan integriert sein. Da die zentralen Lebensziele und Ideale das „Selbstkonzept“ oder „normative Selbst“ einer Person konstituieren, muss der freie Wille mit dem normativen Selbst übereinstimmen (Kap. 1.1). Willensfreiheit ist daher gleichbedeutend mit Selbstbestimmungoder „Selbstübereinstimmung“ sowie AutonomieFreiheitWillens-, Autonomie (positive) oder „Selbstgesetzgebung“, weil sich die Person mit ihrem Selbstkonzept und ihren Lebenszielen ihr „eigenes Gesetz“ gibt und diesem in ihrem Wollen und Handeln Ausdruck verleiht. Nur wenn sie im Einklang mit ihrem normativen Selbstbild handelt, tut sie das, was sie wirklich tun will.
Читать дальше