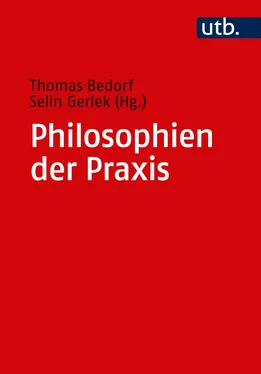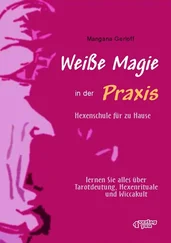‚Linkshegelianer‘ stellt einen zeitgenössischen Klassifikationsbegriff dar, den diese zum Teil auch auf sich selbst anwandten, um sich von ihren Gegnern abzugrenzen. Die Gruppe und ihr Selbstverständnis zerfielen Mitte der 1840er Jahre. Der Zerfall beschleunigte sich durch politische Verfolgung, Verbote ihrer Zeitschriften und durch interne Streitigkeiten. Einzelne Mitglieder wurden ins Exil gezwungen (Zur soziologischen Analyse dieser Gruppe als kritische Intellektuelle vgl. Eßbach 1988). Sie interpretierten teils Hegel selbst, teils nahmen sie als Konsequenz aus dessen Schriften an, dass seine Philosophie als Ausdruck einer antireligiösen, vor allem antitheologischen Haltung zu verstehen sei, die sich kritisch gegen die herrschenden politischen Verhältnisse ihrer Zeit wende. Als Gegner sahen sie insbesondere die Gruppe der ‚Rechtshegelianer‘, die eine konservative Deutung der hegelschen Religionsphilosophie vertrat und damit Möglichkeiten bot, die politisch repressiven Verhältnisse der Zeit zu legitimieren. Einige der Hegelianer lassen sich jedoch keiner der beiden Gruppen zuordnen und werden zumeist als ‚Zentrumshegelianer‘ bezeichnet; sie versuchten eine mittlere Stellung zwischen den Extremen zu wahren und weder politisch liberale Positionen vollständig zu räumen noch mit dem Staat in Konflikt zu geraten.
Der Ausdruck ‚Linkshegelianer‘ wird im Beitrag verwendet, ohne damit eine Wertung präjudizieren zu wollen.
2.2. Die Genese der Linkshegelianer
2.2.1 Die Dimension der Zukunft
Eduard Gans (1797–1839) hielt als direkter Schüler Hegels in Berlin sehr populäre Vorlesungen zur hegelschen Rechtsphilosophie, in denen er deren politisch progressive Züge betonte, während er die konservativen Aspekte in den Hintergrund treten ließ. Im Vorwort seiner Neuherausgabe der hegelschen Rechtsphilosophie artikulierte er erstmals eine gewandelte Einstellung zum hegelschen System (vgl. Gans 1833, 248). Zugleich richtet Gans seine Hoffnungen auf die Zukunft, die in Hegels System, näher in seiner Philosophie der Weltgeschichte, keine Rolle spielt. Gans hingegen suggeriert, dass gerade die hegelsche Theorie, so sie sich in der Gesellschaft durchsetzt, eine gesellschaftsverändernde Kraft aufweise, die dann über sie selbst hinausführe.
Die zentrale Dimension der Zukunft wurde durch Graf August von Ciezkowski (1814–1894) aufgegriffen. In seinem Buch Prolegomena zur Historiosophie wirft Ciezkowki Hegel vor, dieser habe in seiner Geschichtsphilosophie „mit keiner Sylbe der Zukunft erwähnt“ (Ciezkowski 1838, 8), ja darüber hinaus behauptet zu haben, die Philosophie habe nur eine „rückwirkende Kraft“ (ebd., 9). Ziel des Grafen ist es nicht, jedes Spezifikum oder die konkreten Handlungen einzelner Individuen vorhersagen zu können, sondern die Etablierung allgemeiner Gesetze, die auf Basis einer Transformation des hegelschen Systems möglich sein sollen. Ciezkowski teilt die Weltgeschichte in drei Stadien ein, die er dem Gefühl (Antike), dem Denken (Gegenwart) und dem Willen (Zukunft) zuordnet. Der |75|Wille bzw. die dritte, noch in der Zukunft liegende Phase soll sich dabei durch die Verbindung von Gefühl und Denken auszeichnen und als Wille eine freie gesellschaftliche Gestaltung ermöglichen, deren zukünftiges Eintreten durch die spekulativen Geschichtsgesetze garantiert sei. Diese zukünftige Phase zeichnet sich demgemäß für Ciezkowski als Einheit von Theorie und Praxis aus. Diese Einheit lässt sich explizieren als geplante und kontrollierte Realisierung einer freien Gesellschaft. „Die dritte Determination endlich gehört der Zukunft an, sie wird das objective, wirkliche Realisiren der erkannten Wahrheit; und das ist eben das Gute, d.h. das Practische, welches das Theoretische schon in sich enthält.“ (ebd., 17) Die welthistorisch bedeutsamen Akteure der Zukunft seien demgemäß nicht mehr „blinde Werkzeuge“ , sondern „bewusste Werkmeister ihrer eigenen Zukunft“ (ebd., 20, kursiv i.O.). Unter einer somit praktisch transformierten hegelianischen Philosophie versteht Ciezkowski mithin eine Philosophie, die nicht mehr auf das Erkennen des Absoluten ausgerichtet ist, sondern perfektionistisch auf die Herbeiführung der „Endbestimmung der Glückseligkeit“ (ebd.,70).
Für die weitere Entwicklung der linkshegelianischen Debatten und ihrer kritischen Rezeption bei Marx sind zwei Merkmale des Ciezkowskischen Vorschlags entscheidend: (i) zum einen seine deutliche Umstellung der spekulativen Philosophie auf die Zukunft, mit der der Anspruch einhergeht, mit philosophischen Mitteln ließen sich nicht nur gegenwärtige oder vergangene Gesellschaften auf ihre Legitimität hin prüfen, sondern auch bezüglich zukünftigen Fortschritts böte die Philosophie (zumindest) einen Orientierungsmaßstab. Mit dieser Umstellung geht zudem der Anspruch einher (ii), dass die Philosophie eine Theorie bereitstelle, mittels derer praktische Veränderung legitimiert und motivational angetrieben werden könne.
Freilich verhält sich die zweite Umstellung bei Ciezkowski relativ unklar zu seiner Vorstellung einer mit philosophischen Mitteln garantierten Herbeiführung der freien Gesellschaft der dritten Phase. Dieses Problem, die Vorschläge zu einer kritischen Transformation gegenwärtiger Gesellschaftsordnung mittels historischer Gesetzmäßigkeiten abzusichern, schlug sich in zahlreichen Marxismen (auch bei Marx selbst) in unterschiedlicher Gestalt nieder. Dabei ist gerade fraglich, inwiefern sich der Anspruch, eine Veränderung gesellschaftlicher Praxen durch theoretisch angeleitete Vorschläge im Sinne einer praktischen, auf das Gute abzielenden Philosophie mit der rein theoretischen Etablierung historischer Gesetzmäßigkeiten kompatibel machen lässt. So schwankt Ciezkowski zwischen deskriptiven Prognosen und normativen Aufforderungen. (vgl. Schweikard 2015).
Der Einsatz der hegelschen Philosophie zu praktischen Zwecken ging bei den Linkshegelianern einher mit einer Kritik der Religion, auf die hier kurz ein Blick geworfen werden soll, da die dort entwickelten theoretischen Ressourcen für die Praxiskonzeption insbesondere des frühen Marx nicht ohne Folgen blieben und sich hier exemplarisch vorführen lässt, inwiefern die Linkshegelianer Philosophie als Kritik einer Praxis betrieben.
|76|2.2.2. Kritik der politischen Verhältnisse
Neben den religionskritischen Denkfiguren, die vor allem von David Friedrich Strauß (1808–1874) durch sein Buch Das Leben Jesu (1835), in die Debatte eingeführt und im Gefolge in radikalisierter Form von Ludwig Feuerbach und Bruno Bauer (1809–1882) vorangetrieben wurden, finden sich zudem geschichtsphilosophische Denkfiguren, die explizit fordern, das hegelsche Primat der theoretischen Philosophie durch eine Form der Praxis zu ersetzen.
Während Gans sich diese Praxis noch als sukzessive Realisierung des von Hegel normativ Geforderten vorstellte, halten Arnold Ruge (1802–1880) – der als Herausgeber zahlreicher kritischer Publikationsorgane der Linkshegelianer eine wichtige Figur für die publizistische Wirksamkeit der Gruppe darstellte – und Moses Hess (1812–1875) gerade auch das eigene primär publizistische Handeln bereits für eine Realisierung der geforderten Praxis. Die Philosophie müsse als Mittel der Kritik der politischen Verhältnisse das Katheder verlassen und gesellschaftlich wirksam werden. Hier zeigt sich, dass die eingeforderte Praxis auch eine Lebensform zum Ausdruck bringen sollte, in welcher der Philosoph sich durch seine publizistische Tätigkeit selbst als Moment der Veränderung begreift. Diese mit großer Emphase eingeforderte Praxis bleibt bei den Linkshegelianern aber begrifflich unterbestimmt. Ihre Funktion ist eher rhetorisch zu erfassen und in der wechselseitigen Bestärkung und Sehnsucht nach Überwindung der politischen Verhältnisse zu sehen. Ihre negative Funktion zeigt die Praxisemphase durch die Abkehr bzw. Überwindung der hegelschen Philosophie, wobei insbesondere deren Abgeschlossenheit kritisiert wird, die die Möglichkeit weiterer sinnvoller politischer Veränderungen auszuschließen scheint. Daher versuchen die Linkshegelianer eine Depotenzierung des absoluten Geistes auf die Geschichtsphilosophie vorzunehmen (vgl. Quante 2009b), die zugleich um die Dimension der Zukunft erweitert wird. Arnold Ruge behauptet in seinen geschichtsphilosophischen Aufsätzen etwa, dass eine Veränderung der politischen Verhältnisse letztlich unvermeidlich sei, um so die Politiker dazu zu bewegen, diese Veränderungen herbeizuführen, da diese ansonsten nicht durch eine Reform, sondern durch eine Revolution einträten (vgl. Rojek 2015) und daher die Gefahr des Fanatismus bestehe (vgl. Ruge 1841, 289ff).
Читать дальше