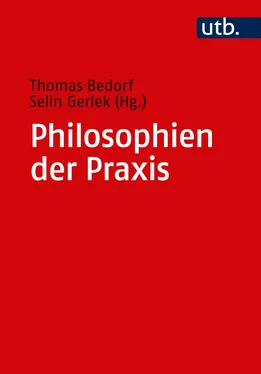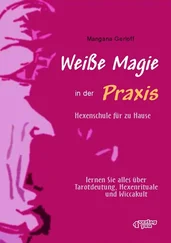Diese Komödie der allseitigen Enttäuschung zeigt den Irrtum der konstitutionstheoretischen Auffassung, dass das Zusammenstimmen der beiden Perspektiven auf das wirkliche Tun etwas sei, das die Beteiligten irgendwie öffentlich gemeinsam und absichtlich herzustellen hätten . Die Öffentlichkeit steckt aber bereits in der Vorstellung des individuellen Wollens: Dem handelnden Individuum ist „nicht um die Sache als diese seine einzelne zu tun, sondern um sie als Sache , als Allgemeines, das für alle ist“. Dass „alle“ Anderen sich „für betrogen halten“ dürfen, weil ihre Perspektive stets nur als eine weitere subjektive, nie als eine objektive Perspektive akzeptiert werden kann, ändert nichts daran, dass die Form des Handelns auf solche Allgemeinheit ausgerichtet ist. Die „Verwirklichung ist […] eine Ausstellung des Seinigen in das allgemeine Element, wodurch es zur Sache aller wird und werden soll“ (Hegel 1807, 308f.). Ein gutes Handeln wäre genau insofern wirklich, als es in gleicher Weise die Sache aller ist: „ein Wesen, dessen Sein das Tun des einzelnen Individuums und aller Individuen, und dessen |64|Tun unmittelbar für andere oder eine Sache ist und nur Sache ist als Tun Aller und Jeder ; das Wesen, welches das Wesen aller Wesen, das geistige Wesen ist“ (Hegel 1807, 310). Das ist keine Übereinstimmung, die Individuen sich sinnvoll herzustellen vornehmen könnten – denn es ist klar, dass bloß faktische Zustimmung auch beliebig vieler Individuen ein Handeln nicht gut macht, so wie bloß faktische Zustimmung auch beliebig vieler Anderer mein µ- en nicht zu einem φ -en macht. Es zeigt aber, wie man die normative Gutheit geistigen Tätigseins, die in der Gewohnheit unmittelbar (aber damit eben auch un-gewußt) gegeben war, und die im Handeln formal (und damit notwendigerweise prekär) ist, als wirklich begreifen kann: Nicht, indem man einen bestimmten Inhalt des Wollens als etwas erweist, das vernünftigerweise alle wollen sollten, sondern indem man den Vollzug des Handelns als je schon über-individuell versteht. So wird ein Verständnis des Vollzugs möglich, in dem das handelnde Individuum sich unmittelbar als vereinzeltes Exemplar einer Allgemeinheit weiß, als ein soziales Ensemble, oder als „das Subjekt, worin die Individualität [das handelnde Individuum] ebenso als sie selbst oder als diese wie als alle Individuen ist, und das Allgemeine, das nur als dies Tun Aller und Jeder ein Sein ist, eine Wirklichkeit darin, daß dieses Bewußtsein sie als seine einzelne Wirklichkeit und als Wirklichkeit Aller weiß“ (Hegel 1807, 310f.). Die Wirklichkeit des Vollzugs manifestiert sich darin, dass eine Handelnde sich als So-Handelnde weiß. Sie weiß sich aber als Handelnde notwendig in der Spannung zwischen ihrer und der Perspektive der Anderen auf ihr Tun; sich als Subjekt seines Handelns denken heißt dann, sich im Verhältnis zu diesen Anderen denken.
4.4. Anerkanntsein: Die soziale Form des praktischen Selbstbezugs
Dass der Selbstbezug den Bezug auf Andere immer schon beinhaltet, ist vielleicht der wirkmächtigste, jedenfalls populärste Gedanke der hegelschen Praxisphilosophie: „Das Selbstbewußtsein ist an und für sich , indem und dadurch, daß es für ein Anderes an und für sich ist; d.h. es ist nur als ein Anerkanntes“ (Hegel 1807, 145).
Im direkten Anschluss an diese Formulierungen hat sich eine kaum noch überschaubare Diskussion zur „Anerkennungstheorie“ entwickelt.
Diese Anerkennungstheorie versteht das hegelsche Projekt typischerweise im Sinn der konstitutionstheoretischen Lesart. Sie will die Frage, wie man im Vollzug seines Handelns praktisch um sich weiß, durch eine Erzählung beantworten, wie Selbstbewusstein zustandekommt (vgl. als exemplarische Initialbeiträge der Debatte Siep 1979 und Honneth 1992). Die Leiterzählung der Anerkennungstheorie fragt, wie es Subjekten gelingt, sich selbst als Subjekt aufzufassen, wenn sich die übersteigerte Selbstauffassung als unbedingt freies, allein auf monologische Selbstverwirklichung zurückgehendes Subjekt allemal daran breche, dass eine solche Haltung nie zu einem befriedigenden , abschließenden Selbstverständnis komme. Dazu bedürfte es eines objektiven Urteils, und das bedeute: des Urteils eines anderen Subjekts. Die Notwendigkeit einer solchen externen Perspektive erzwinge so, dass Subjekte ihre Selbstauffassung auf andere Subjekte hin relativieren , und so ihre Abhängigkeit von anderen Subjekten akzeptieren. Der |65|anerkennungstheoretische Antwortvorschlag ist also, dass Subjekte sich gleichsam im Spiegel anderer Subjekte selbst begegnen und erkennen. Diese Bezogenheit auf andere ist sowohl eine faktische Bedingung menschlicher Subjektivität (man wird Subjekt durch Erziehung und Bildung, man bedarf des psychischen und emotionalen Rückhalts); sie ist aber auch eine logische Bedingung (man begreift die eigene Autonomie falsch , wenn man sich nicht als Anderer für Andere begreift, als Subjekt unter Subjekten). Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, kommt es zu schmerzhaften, manchmal zerstörerischen pathologischen Effekten. Umgekehrt ist die Erfüllung der Anerkennungsbedingungen – stufenweise aufsteigend: in intersubjektiven Nahbeziehungen („Liebe“), in interpersonalen Sozialbeziehungen, schließlich im bürgerlichen Recht – die Voraussetzung dafür, dass sich durch allgemeine und allseitige Anerkennung ein „allgemeines moralisches Bewußtsein“ realisiert (s. Siep 2000, 214). Diese „spezifische Moral menschlicher Intersubjektivität“ resultiert nach der anerkennungstheoretischen Erzählung aus einem „wechselseitigen Reaktionsverhalten“: „Ego und Alter ego reagieren zeitgleich aufeinander, indem sie jeweils ihre egozentrischen Bedürfnisse einschränken, wodurch sie ihre weiteren Handlungen vom Verhalten ihres Gegenübers abhängig machen“ (Honneth 2010, 31).
Diese anerkennungstheoretische Erzählung entfaltet eine Variante des subjektphilosophischen Modells: Sie geht von der Vorstellung eines selbstgenügsamen Subjekts aus, bemerkt, dass diese Vorstellung der vorgängigen Anerkennung durch „Andere“ bedarf, und verallgemeinert dies zur Bedingung wechselseitiger Anerkennung. Man wird, gleich, für wie nützlich oder plausibel man diese Erzählung beurteilen mag, sagen müssen, dass sie die praxisphilosophische Ausgangslage zumindest verzerrt. Sie nimmt Hegels Entdeckung der notwendigen Perspektiven auf das eigene Tun (als subjektives „Tun“ und als objektive „Tat“) auf und empfiehlt, dass man ihre Spannung in einen perennierenden Prozess der „Anerkennung“ übersetzen möge. Gelingendes Selbstbewusstsein, verspricht diese Erzählung, ist das Ergebnis eines solchen Prozesses. Das kann praxisphilosophisch aber nicht stimmen – denn würde „Selbstbewusstsein“ in dieser Weise zustandekommen können, dann läge die „Doppelsinnigkeit des Unterschiedenen“ (dass der eigene Vollzug wesentlich in zwei Perspektiven auftaucht) nicht „in dem Wesen des Selbstbewußtseins, unendlich oder unmittelbar das Gegenteil der Bestimmtheit, in der es gesetzt ist, zu sein“. Käme „Selbstbewusstsein“ durch den „Prozess der Anerkennung“ zustande, dann wäre dieser Perspektivenkonflikt nicht sein Wesen ; die perspektivische Spannung wäre nur ein zu überwindendes Hindernis . Die Praxisphilosophie dagegen hebt gerade mit der Entdeckung dieser Spannung im Vollzug unserer geistigen Tätigkeiten an: „Die Auseinanderlegung des Begriffs dieser geistigen Einheit in ihrer Verdopplung stellt uns die Bewegung des Anerkennens dar“ (Hegel 1807, 145f.). Die Erzählung von der „Bewegung des Anerkennens“, sagt Hegel, ist nicht das dargestellte Ergebnis einer „Auseinanderlegung des Begriffs“, sondern die „Auseinanderlegung des Begriffs“ wird als „Bewegung des Anerkennens“ dargestellt . Man muss eine methodische Geschichte erzählen, um zu sehen, wo das traditionelle Bild praktischen Selbtwissens einseitig ist.
Читать дальше