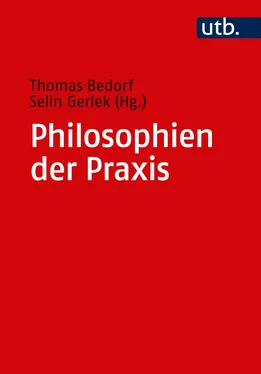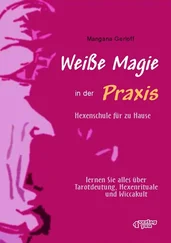Hegel führt diese konflikthafte Gestalt detaillierter am bürgerlichen Recht als der Realisierungsform unserer Praxis vor, und die eigentlich unentschuldbare Aussparung der Rechtsform aus dieser Skizze der hegelschen Praxisphilosophie hat den Preis, dass sie ein unangemessen abstraktes – nämlich von einer zentralen Bestimmung des sittlichen Mediums unserer konkreten menschlichen Angelegenheiten absehendes – Bild zeichnet. Die Aussparung motiviert sich durch die ungeheure Breite, die im Forschungs- und Aneignungsdiskurs der Zusammenhang von „Recht“ und „Moral“ und von „Sittlichkeit“ und „Politik“ einnahm (vgl. nur Menke 1991, 1996 u. 2018, Weisser-Lohmann 2011), und der zur Frage nach dem systematischen Kern von Hegels Praxisphilosophie nicht unmittelbar beiträgt. Trotzdem wird alles falsch, wenn er einfach fehlt, weil erst mit den Details der Rechtsphilosophie die Form des gemeinsamen Lebens, auf die Hegel abzielt, als eine gesellschaftliche , genauer: eine republikanische Form verständlich wird, und erst in diesem Licht die problematischen Aspekte an der Figur der „Sittlichkeit“ – etwa ihre vormodernen Konnotationen – unübersehbar werden (vgl. Novakovic 2017).
Deshalb ist die Figur des Verzeihens, mit der die Erzählung von der „Bewegung des Anerkennens“ endete, für Hegels Praxisphilosophie emblematisch. Sie ist nur vor der begrifflichen Folie einer Idee der Sittlichkeit, oder einer Idee des gelingenden gemeinsamen Lebens verständlich, und ihre Beschreibung selbst exemplifiziert diese Idee. Sie versteht zugleich die Wirklichkeit solchen Gelingens als prekär, weil die normative – aus unpersönlicher Perspektive „moralische“, aus individueller Perspektive „ethische“ – Problemlage irreduzibel nur zur Erscheinung kommt in, und also immer bestimmt bleibt durch, die konkrete Beziehung zwischen Individuen. Deren Beziehung betrifft deshalb, weil sie im Horizont der objektiven normativen Ansprüche steht, die die Situation exemplifiziert, auch die Art, in der sie um sich wissen und sich zu sich selbst verhalten, wie sie – ganz konkret und bis in ihre affektive Leiblichkeit hinein – selbstbewusst sein können. Die Figur des Verzeihens macht so die Wirklichkeit einer praktischen Situation anschaulich, die die Form ihres Gelingens manifestiert, ohne selbst gelungen zu sein ; sie verdeutlicht, wie die glückliche Auflösung einer solchen Situation auf das Tun und Handeln der beiden Beteiligten angewiesen ist (und ohne es sich nicht einstellen kann), ohne andererseits der Ideologie reiner praktischer Selbstbestimmung Vorschub zu leisten, weil die glückliche Auflösung nie von subjektivem Tun allein „bewirkt“ wäre. Und schließlich führt die Figur vor, dass die Vorstellung von Sittlichkeit, unmittelbar gelingender Praxis, allemal zurückverwiesen bleibt auf das praktische Medium der Artikulation und Überwindung dieser Unmittelbarkeit. Verzeihen ist, als Koinzidenz praktischer Haltungen , auch die Koinzidenz verzeihender Reden oder logoi ; und das ganze Projekt der hegelschen Praxisphilosophie fokussiert auf solche Artikulation der Praxis. „Wir sehen hiermit wieder die Sprache als das Dasein des Geistes“, in dem die gespannten Perspektiven auf das Tätigsein, und damit das Tätigsein selbst , seine anschauliche, gegenständliche, |72|wißbare – und damit erst potentiell selbstbewusste – Form manifestiert. Im Miteinander-Sprechen „vernimmt [ein Selbst] ebenso sich, als es von den anderen vernommen wird, und das Vernehmen ist eben das zum Selbst gewordene Dasein “ (Hegel 1807, 478f.). Darin, dass Hegel solche Situationen als eine angemessene Exemplifikation der Form wirklichen menschlichen Tätigseins – jenseits konstitutionstheoretischer Zurückführungssehnsüchte, jenseits empiristisch vorausgesetzter Sachgebietsunterscheidungen wie „Handeln“-„Denken“, „Vernunft“-„Gefühl“, schließlich jenseits naturalisierender oder theologisierender Großerzählungen – ausschließlich aus der Immanenz unserer wirklichen Lebensvollzüge entwickelt, und diese Selbstreflexion unserer Praxis als Form und Gehalt von Vernunft verständlich macht, liegt seine kolossale Zumutung an unsere denkerische „Unbefangenheit“, und seine Bedeutung für jede Praxisphilosophie.
Lektüreempfehlungen
Den vielleicht mitreißendsten Einstieg in sein Nachdenken über Praxis bietet Hegels Phänomenologie des Geistes . Der einführende Kommentar von Bertram (2017) eröffnet eine praxisphilosophische Perspektive auf den Text; der ausführliche und anspruchsvollere Stellenkommentar von Stekeler-Weithofer (2014a) situiert ihn in modernen Debatten der Handlungstheorie und der philosophy of mind . Über Hegels Projekt im Ganzen orientieren einführend Taylor (1975) und die zugängliche Studie von Henrich (1991), sowie – in englischer Sprache – die Arbeiten von Pinkard (1994 und 2012) und Pippin (2008); sie empfehlen sich besonders wegen ihrer sprachlichen und terminologischen Unbeschwertheit. Für gegenwärtige Debatten fruchtbare Anschlüsse zeigen schließlich beispielhaft Menke (1996 u. 2018, über die problematische Rolle der Sittlichkeit für die moderne Moralphilosophie) und Honneth (2001, mit einer am Problem der Anerkennung interessierten Einführung in Hegels Rechtsphilosophie).
[Zum Inhalt]
|73|Die Einheit von Theorie und Praxis. Praxiskonzepte vom Linkshegelianismus bis zum historischen und dialektischen Materialismus
Tim Rojek
Dieser Artikel vermittelt einen historisch gegliederten Überblick über die zentralen Praxiskonzepte, die im Rahmen einer inhaltlich heterogenen Ansammlung verschiedener Autoren vorzufinden sind, die sich dem Versuch verschrieben haben, die Philosophie als Wissenschaftstyp entweder so zu transformieren, dass politische Intervention zur Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit ein Teil der Philosophie wird oder aber diese selbst zugunsten eines neuen Typs von Wissenschaft zu überwinden, in dem Theorie und Praxis eine Einheit bilden. Während im zweiten Teil insbesondere die im Kontext des Linkshegelianismus entwickelten Praxiskonzepte präsentiert werden, wird sich der dritte Teil demjenigen von Karl Marx zuwenden. Im vierten Teil wird dann das heterogene Theoriekonglomerat des historischen bzw. dialektischen Materialismus als diejenige Ausgestaltung der marxistischen Tradition präsentiert, die den ‚Marxismus‘ als theoretische Strömung etablierte. Es ist dann wiederum diese Strömung, welche die zentrale Bezugsgröße für die im Folgenden behandelten Autoren und deren Praxiskonzeptionen bildet. Diese beziehen sich teils positiv, teils kritisch auf den historischen Materialismus. Es ergibt sich so eine problemgeschichtliche Schneise durch die von der kritischen Hegelrezeption der Linkshegelianer ausgehende Entwicklung derjenigen theoretischen Vorschläge, durch die – von einem politischen progressiven Selbstverständnis geprägt – versucht wurde, Philosophie selbst praktisch werden zu lassen.
2. Praxis und Linkshegelianismus
2.1. Linkshegelianer als Gruppe
Für die Linkshegelianer bildete die hegelsche Philosophie in Gestalt des Systems, das in Form der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (letzte bearbeitete Ausgabe 1830) vorlag, den Ausgangspunkt ihrer kritischen Anknüpfung. Hegel galt ihnen als zentraler, wenn nicht gar letzter Schritt der Philosophie. Es handelte sich um eine relativ heterogene Gruppe junger |74|Wissenschaftler zumeist aus dem Umfeld der Philosophie und Theologie, die in ihren Schriften radikale politische Forderungen nach Liberalität und Demokratie vorbrachten, dies teils in Gestalt einer massiven Religionskritik.
Читать дальше