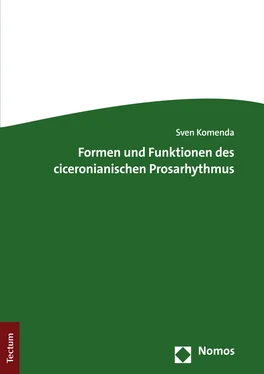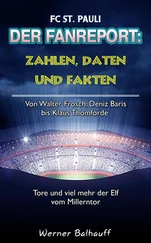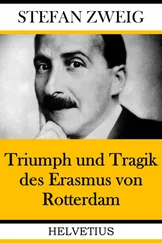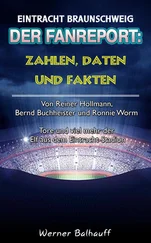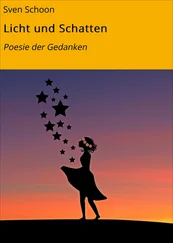Um diese einleitenden Erwägungen zusammenzufassen: Den etwaigen Gebrauch der sogenannten Klauseln des Koinzidenzrhythmus werden wir anhand einer korpusbasierten Analyse durch ein close reading untersuchen. Wir besprechen dabei das ggf. planmäßige Auftreten von Klauseln vor allem auf Wortgruppen- und Periodenebene und stellenweise darüber hinaus. Auch stellen wir die Frage, ob in der ciceronianischen Periode bevorzugte Kollokationen bestimmter Klauseln gegeben sind, welche ihrerseits einem konkreten Zweck dienen, was für uns vor allem bedeutet, dass sie inhaltsgetragen sind. 13Davor sind wie angedeutet einige theoretische Fragen zu erörtern.
Besprochen werden (nach einer Voruntersuchung, welche sich auf die ersten Perioden der 4. Catilinarie bezieht) in Auszügen von je etwas mehr als 300 sogenannter Kola, im Sinne eines chronologisch und inhaltlich repräsentativen Querschnittes die Rede Pro Quinctio (81 v. Chr.), die zweite Rede De lege agraria (63 v. Chr.) und die vierzehnte und damit letzte Philippische Rede (43 v. Chr.). 14
1.2 Prosarhythmus und Textinterpretation
Da aber nun einmal die primär statistische Herangehensweise die bisherige Prosarhythmusforschung eindeutig dominiert, scheint nach der Ankündigung unseres Vorgehens eine eingehendere Begründung geboten; auch möchten wir uns zu einigen der besagten Verfahren positionieren. Eine überblicksartige Aufbereitung der relevanten Forschungsarbeiten wurde bis dato allerdings schon mehrfach unternommen, 15sodass wir davon nicht gänzlich abrücken, aber gewisse Schwerpunkte setzen möchten.
Es ist zunächst keine neuartige Feststellung, dass im bisherigen Forschungsverlauf selbstverständlich Analysekriterien im Sinne statistischer Argumente erarbeitet wurden, welche über präferierte Formen der prosarhythmischen Ausgestaltung Auskunft geben sollten. Es zeigt sich dennoch, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, die Vielzahl der in solchen Arbeiten diskutierten „rhythmischen“ Schlüsse für einen qualitativ-interpretierenden Ansatz zu adaptieren. Die folgenden Beispiele der Arbeiten FRAENKELS, KOSTERS und STRÄTERHOFFS stehen auf halbem Wege zwischen den bezeichneten Ansätzen und einem wirklich qualitativ-interpretierenden Vorgehen und begehen unserer Meinung nach den Fehler, keine wirklich überprüfbare und leider sogar keine von reiner Willkür freie Form der Klauselnotation zu verwenden.
STRÄTERHOFF hat den zumindest ähnlichen Anspruch eines den Prosarhythmus Kolon für Kolon interpretierenden Vorgehens an ihre Dissertation gestellt. 16Da ihr Ansatz (nach demjenigen BLÜMERS) unserer Arbeit wohl am nächsten kommt, möchten wir nun zuerst auf sie zu sprechen kommen. STRÄTERHOFFS Vorgehen besteht darin, den lateinischen Text nach einer an FRAENKELS Prinzipien (mit welchen wir uns in Kapitel 2.4auseinandersetzen werden) orientierten Segmentierung prosarhythmisch zu analysieren und zu kommentieren. Prinzipiell ist damit bereits der Weg für einen sehr vielversprechenden Untersuchungsmodus vorgezeichnet. Vor allem auch aufgrund ihrer Entscheidung, inhaltlich enger zusammengehörige Kola/Textsegmente in ihrer Textdarstellung zu kennzeichnen. 17Leider krankt ihr Ansatz an dem bereits angedeuteten Kernproblem: Die Anzahl ihrer „Klauseln“ (es handelt sich nach unserer Zählung um 22, wenn man von den Variationen der Grundformen – eine Länge kann unter Variation der Silbenzahl durch zwei Kürzen ersetzt werden – absieht), 18die darauf angelegt ist, eine große Bandbreite von Quantitätenfolgen festzuhalten und mit einem Kürzel zu „etikettieren“, ist nicht nur äußerst umfangreich, sondern hält die Position der Wortakzente überdies nicht gesondert fest. 19Während also ihrem Vorgehen einer textnahen Betrachtung auf Basis einer reflektierten kolometrischen Gliederung prinzipiell nur zugestimmt werden kann, dürfte es sich als beinahe unmöglich erweisen, mit einem derartig umfangreichen, rein auf Quantitäten beruhenden Notationssystem eine vielleicht nur annähernde, aber doch ggf. intendierte und insbesondere vielleicht auch auf Akzentmustern beruhende Gleichheit bestimmter Textsegmente nachzuweisen. Vor allem aber können mit diesem System Akzente als eigene Größe gar nicht erst losgelöst von etwaigen anderen Faktoren diskutiert werden.
Zu diesem Problem, welches also darin liegt, dass eine intendierte Gleichheit erkannt und wiedererkannt werden muss, kommt das damit einhergehende einer gewissen Willkür bei der Erfassung des Prosarhythmus: hier sind auch FRAENKEL und KOSTER zu nennen, wobei die Leistungen des erstgenannten auf dem Gebiet der Kolometrie dennoch unangefochten sind und wahrscheinlich das wichtigste Standbein unserer eigenen Forschung darstellen. Den Prosarhythmus gerade auf diese Einheiten zu beziehen, ist absolut notwendig. Jedoch wurde das auf FRAENKEL zurückgehende systematische Vorgehen bei der Kolonsegmentierung u. a. von SCHMID und damit von KOSTER, der lediglich den zuerst genannten rezipiert, 20verkannt; für SCHMIDS und KOSTERS Vorgehen spricht dennoch, dass ihre Analyse einer gewissen Ganzheitlichkeit der Kola Rechnung zu tragen versuchen, wie KOSTER betont. 21Es handelt sich um einen Standpunkt, dem wir unbedingt zustimmen, während wir hierunter allerdings keinen das Kolon vollständig erfassenden Prosarhythmus verstehen (diesen mag es geben oder nicht), sondern vor allem den Aspekt der Konzinnität und der möglichen Organisationsformen prosarhythmisch überarbeiteter Kola. Wenn wir uns im Folgenden also mit den (nicht nur von uns) gesehenen Kritikpunkten beschäftigen, möchten wir wie zuvor damit nicht den generellen Wert dieser Arbeiten in Frage stellen. Vielmehr ergeben sich bei Sträterhoff auch aus dieser Kritik die Erkenntnispotentiale eines ganz andersartigen, nämlich wirklich qualitativ-interpretierenden Vorgehens, das nach dem Sinn des Prosarhythmus fragt und die Zahl seiner Klauseln stark beschränkt.
Für FRAENKEL wie für KOSTER und SCHMID kann jedoch als Axiom festgehalten werden, dass etwa Cicero ihrer Ansicht nach zu praktisch jedem Zeitpunkt „rhythmisch“ geschrieben habe (wobei wir zunächst die Frage zurückstellen, was genau damit gemeint sein könnte) oder dass vielmehr jede seiner Schriften vollständig mit einem wie auch immer gearteten Prosarhythmus durchzogen sei. Derartige Ansätze laufen nicht nur darauf hinaus, dass selbstverständlich jedwede Lautformation als „rhythmisch“ erachtet wird, sondern dass im Prinzip gar keine Möglichkeit dafür offengelassen wird, dies an Ort und Stelle zu widerlegen, zumindest zu hinterfragen.
Hier sei also das bereits von BLÜMER besprochene Beispiel FRAENKELS genannt, der seinerseits sogar 33 Klauselformen zuzüglich ihrer Variationen benennt. 22Wie möchte ein derartiger Ansatz seine Befunde also untermauern oder wie könnte innerhalb des gewählten Systems überhaupt noch eine Falsifikation stattfinden? Für FRAENKEL muss man wohl sagen, dass dies schlicht unmöglich ist. 23Damit ist allerdings auch die Aussagekraft seiner Untersuchung sehr stark eingeschränkt.
Doch auch rezente Arbeiten, wie etwa die jüngst von KOSTER vorgelegte prosarhythmische Analyse der Rosciana Amerina, verkörpern noch immer diese Fehlentwicklungen. Wir meinen damit Folgendes: KOSTER greift wie gesagt auf das bereits von DREXLER und im Anschluss an ihn in LEUMANN-HOFMANN-SZANTYR zurecht kritisierte System SCHMIDS zurück. 24Dass die Ansicht eines gewissermaßen immer währenden Prosarhythmus von SCHMID gar auch dort zum Prinzip erhoben wurde, wo Cicero explizit das Gegenteil beschreibt, tadelt hierbei bereits DREXLER ausdrücklich im Rahmen seiner Rezension. 25Dieses Vorgehen strebt in seiner Ganzheitlichkeit dazu, jede Lautformation zum Prosarhythmus zu erheben und es überlässt die Kolometrie dem bloßen rein subjektiven Sprachgefühl. 26Ganz davon abgesehen, dass somit auch die Konzinnität zu keiner Würdigung gelangen kann, degradieren SCHMID und KOSTER den Prosarhythmus de facto zur bloßen Sprachmelodie. Die Darstellung des Prosarhythmus (Notation über dem recht willkürlich kolometrisch geordneten Fließtext) scheint mit dessen Interpretation gleichgesetzt, zumindest für einen bereits ausreichenden Modus der Untersuchung erachtet zu werden.
Читать дальше