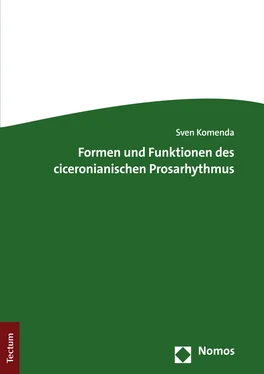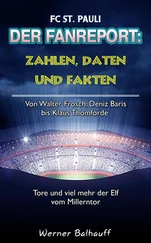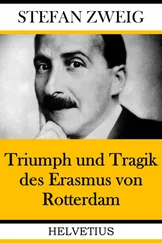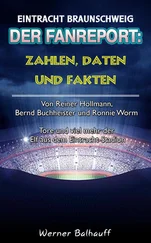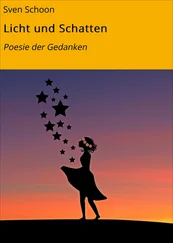Wenn diese Arbeit zumindest dahingehend einen positiven Effekt auf die Forschung zeitigt, dass sie auch andere zu einer wirklich textnahen Betrachtung und Interpretation des Prosarhythmus reizt, ist bereits viel erreicht.
1Ähnliches ist denn auch von PRIMMER als die Hauptforderung seiner Kritiker wahrgenommen worden. Seine Dichotomie von fallendem und fortsetzendem Rhythmus befähigt ihn allerdings durchaus zu konkreteren Aussagen (PRIMMER 1990, 19 zu seiner Feststellung hinsichtlich der besagten Skepsis vor allem auch S. 27 sowie S. 44 hinsichtlich der Anwendung seiner Pausenstufen). Unser Ansatz ist mit dem seinigen allerdings in seiner jetzigen Gestalt nur in Teilen kompatibel.
2LAUGHTONS Aussage über Walter SCHMIDS Arbeit zum Prosarhythmus Ciceros ist denn auch in genau diesem Sinne zu verstehen: „ … when the reader tries to follow him into the specimens of colometry which form the latter part of the book, he is confronted by metrical schemes so intricate that common sense cries out in protest.“ (LAUGHTON 1979, S. 188).
3HABINEK 1981, 174.
4Beispielsweise ZIELINSKI, PRIMMER oder sogar STRÄTERHOFF, worauf wir in Kapitel 1.2dieser Arbeit zu sprechen kommen werden. Dort werden wir ebenfalls darlegen, dass BLÜMER, auf dessen Arbeit die unsrige fußt, einen ganz anderen Weg beschritten hat.
1 Allgemeine Einführung
1.1 Die Untersuchung des „Prosarhythmus“
Da Arbeiten zum Prosarhythmus wohl doch noch immer eine relative Randerscheinung im Feld der Klassischen Philologie darstellen (vor allem dann, wenn sie den hier gewählten Ansatz verfolgen), möchten wir zunächst umreißen, was man – in grundsätzlicher Übereinstimmung mit der bisherigen Forschung – als den lateinischen Prosarhythmus bezeichnen könnte. Gemeint ist eine bewusste und planmäßige prosodische Ausgestaltung (etwa einer Rede) vermittels regelmäßig wiederkehrender Ketten phonetischer Merkmale mit einer ästhetischen Dimension. Es stellt sich allerdings die Frage, ob in einem Definitionsversuch zur ästhetischen nicht auch eine inhaltliche Dimension sogar zwingend hinzugefügt werden muss.
Um diese Frage zu klären, versuchen wir, eine zusammenhängende Betrachtung derjenigen Faktoren durchzuführen, dank welcher ein Text nach unserer Interpretation der Anweisungen Ciceros als rhythmisiert oder „numerosus“ gelten kann: 5des Prosarhythmus im engeren Sinne (des „numerus“, dessen eigentliche Form ebenso Gegenstand dieser Arbeit sein wird), sowie der „concinnitas“ und der „compositio“; all das auf Basis einer sogenannten „kolometrischen“ Gliederung, auf deren Beschaffenheit wir gleichfalls noch eingehen werden. Es ist zu prüfen, ob auf dieser Grundlage Anhaltspunkte für eine Interpretation gewonnen werden können.
Diese Zielsetzung rührt von Wilhelm BLÜMERS Arbeiten zum konkreten Gebrauch des Prosarhythmus bei Leo dem Großen her und ist damit recht untypisch für die bisherigen Forschungsarbeiten zum Prosarhythmus. Mit „untypisch“ meinen wir das Folgende: In unserem Fach bildet die Erforschung des Prosarhythmus, wie bereits gesagt, ein randständiges Betätigungsfeld. Neben allgemeineren Erklärungsmustern, welche etwa mit einem starken Schwerpunkt zumindest der Klassischen Philologie des deutschsprachigen Raumes auf dezidiert literaturwissenschaftlichen Feldern und damit einem gewissen Desinteresse an den hier diskutierten, teils in die Linguistik hineinreichenden Fragen zusammenhängen, muss allerdings auch konstatiert werden, dass die Ergebnisse der bisherigen Forschung nicht völlig, aber doch wohl viel zu oft rein technisch-statistischer Natur gewesen sind und über eine Dokumentation von relevanten Lautmustern, welche im Falle Ciceros häufig sogar auf bloße Quantitätenmuster beschränkt waren, nicht hinauskamen; obwohl bereits dies keine geringe Leistung darstellt, wird man zurecht danach fragen dürfen, wo hier die praktische Relevanz liegt. 6Interpretierende Forschungsansätze, welche für sich den Anspruch erhoben haben, einen wie auch immer gearteten Prosarhythmus gewissermaßen nicht nur zählen, sondern seinen Gebrauch hinterfragen und, wenn möglich, an Ort und Stelle erklären zu wollen, sind leider noch die Ausnahme. Daher rührt unser Versuch, seine Benutzung im Verlauf eines close reading zu interpretieren.
Das setzt die Klärung einiger wichtiger Teilfragen voraus; allein, welche lautliche Beschaffenheit oder welche Folge phonetischer Merkmale nun als „Prosarhythmus“ zu bezeichnen ist, wird man in vielen Punkten als strittig bezeichnen und weitergehend konstatieren müssen, dass im Falle Ciceros bisher keine im vollen Umfang zufriedenstellende Heuristik durchgeführt worden ist. Unser System der Notation, welches auf den Erfahrungen mit späteren Sprachstufen des Lateinischen beruht und das wir unserer Messung zugrunde legen wollen, werden wir im Einzelnen in Kapitel 2.1besprechen. Ein Unterschied zu den meisten bisherigen Ansätzen zur Untersuchung des Prosarhythmus Ciceros liegt nämlich in der noch zu prüfenden Vorannahme, dass man bereits in seinem Fall von einer Koinzidenzrhythmik 7ausgehen muss, d. h. dass neben den Vokalquantitäten der Wortakzent ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Konstitution des Prosarhythmus gewesen ist. Dementsprechend haben wir uns auch der Aufgabe angenommen, zu überprüfen, ob ein solches Klauselnotationssystem, welches das Akzentmuster als vorrangiges Merkmal zu Kategorisierung und Abgrenzung von Klauseln begreift (in Form einer Art Symbiose von Akzenten und Quantitäten) 8mit einem Erkenntnisgewinn auf Cicero angewendet werden kann. 9
In diesem Zusammenhang werden auch etwaige durch eine prosarhythmische Analyse nahegelegte Organisationsmuster besprochen werden, welche wir in Anlehnung an ZIELINSKI und STRÄTERHOFF auch hier im Kontext des Prosarhythmus als „Responsionen“ 10bezeichnen. Diese sind unserem Anliegen entsprechend ebenfalls daraufhin zu untersuchen, ob ein inhaltsgetragener und/oder strukturgebender Gebrauch vorliegt.
Einen großen Stellenwert muss man ggf. auch allen Erscheinungsformen der sogenannten Konzinnität oder „concinnitas“ zugestehen, auf deren Form und Funktion wir ebenso zu sprechen kommen werden. Ihr Bezug zu den sogenannten „Kola“ und zum Prosarhythmus ist bisher unseres Erachtens noch nicht deutlich genug gesehen worden. Darüber hinaus muss ebenso einiges zum Verhältnis der Klausel und ihrer Organisationsformen zur Konzinnität gesagt werden, da hier eine gewisse Verwandtschaft zu bestehen scheint.
Ferner ist der Begriff des „Kolons“, welches, wie wir noch besprechen werden, eine grundlegende Einheit bei der prosodischen Gliederung ciceronianischer Prosa ist, trotz eingehender Untersuchungen von Seiten der lateinischen und griechischen Sprachwissenschaft in neueren Arbeiten zum Prosarhythmus stellenweise ohne jede theoretische Reflexion benutzt worden. Es liegt jedoch auf der Hand, dass diese grosso modo versartigen, ggf. entsprechend rezitierten Kleinsteinheiten mit einer möglichst großen Genauigkeit bestimmt werden müssen, um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen, wenn man bedenkt, dass die sog. „Klauseln“ gerade am Kolonschluss zu finden sind. Bloße am Inhalt orientierte Sprachintuition, welche uns aufgrund des Vorkommens der gleichen Erscheinungen in den modernen Sprachen 11bis zu einem gewissen Grad bei der Abgrenzung dieser Einheiten tatsächlich unterstützt, kann und darf nicht das einzige Kriterium dieses Arbeitsschrittes, d. h. der „kolometrischen“ Textgliederung, bleiben.
Neben die Besprechung dieses Problems reihen sich weitere spezifische Fragestellungen, welche die Phänomene der Elision und Aphärese betreffen, der Pro- und Enklise oder das etwaige Vorkommen von Nebenakzenten. Diese zuletzt genannten Punkte haben Einfluss auf die Erfassung der für uns relevanten Lautmuster und lassen sich leider nicht immer zweifelsfrei klären. Dennoch macht ihre hohe Frequenz in unserem Korpus eine Entscheidung in diesem Punkt unabdinglich. Wie im Falle von BLÜMER lässt sich hier aber ein Argument aus den Klauseln selbst ableiten, 12wenngleich es sich in unserem Fall auf ihre etwaigen Organisationsformen stützen wird.
Читать дальше