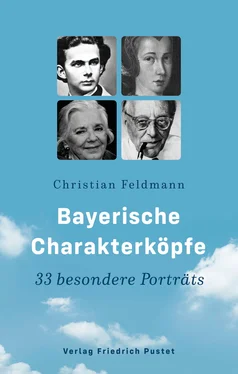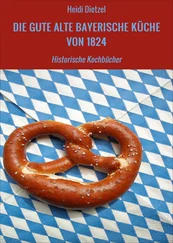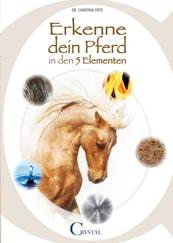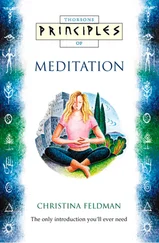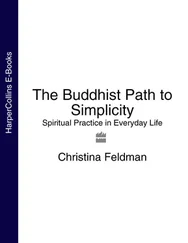Bruder Berthold, der Wundermann, hat auch keine bessere Predigttechnik als die übrigen Bettelmönche. Theologisch ist er ganz gut beschlagen, aber die Bibel zitiert er oft schlampig oder schlicht falsch, er wirft Personen und Fakten durcheinander oder dichtet nach eigenem Gusto dazu. Worin liegt dann das Geheimnis seines durchschlagenden Erfolgs?
Es ist das unnachahmliche persönliche Flair seiner Rede. Es ist die Farbe seiner Bilder, die lebendige Kraft seiner Sprache, die Anschaulichkeit seiner Gleichnisse. Es ist die Virtuosität, womit er eine bunte Vielfalt von Stilmitteln zu bändigen weiß, mit Fantasie, Humor, Lust am Erzählen, nicht ohne boshaften Sarkasmus, manchmal derb, dann wieder charmant, zart lockend und plötzlich in ein Donnerwetter ausbrechend, nicht jedes Mal tiefschürfend in seinen Gedanken, aber immer interessant, häufig von epischer Breite, aber nie langweilig.
Schon die Überschriften, die Bertholds Predigten in den ältesten Sammlungen tragen, machen neugierig: „Von sechs Mördern.“ – „Von zehn Chören der Engel und der Christenheit.“ – „Von zwölf Junkern des Teufels.“ Titel wie Schlagzeilen. „Von des Leibes Siechtum und dem Tod der Seele.“ – „Von rufenden Sünden.“ – „Von achterlei Speise im Himmelreich.“ Die Methode, den Predigtinhalt eingängig aufzulisten, teilt Berthold mit vielen Volkspredigern des Mittelalters bis hin zu Martin Luther.
Langweilig wird dieses Aufzählen nie. Wie ein geschickter Dramaturg beherrscht Berthold den Wechsel von behäbigen Schilderungen und stoßweisen Attacken, reiht er zauberhafte Bilder und Schreckensvisionen aneinander, inszeniert er von der Kanzel herab spannende Dialoge. Er kündigt an, etwas enorm Wichtiges sagen zu wollen, zögert den entscheidenden Satz dann aber so geschickt hinaus, dass sein Publikum bloß noch atemlos auf die erlösende Information wartet.
Berthold arbeitet mit Übertreibungen und grellen Kontrastwirkungen, er führt auf seiner Baumkanzel komplette kleine Dramen auf wie in seiner Predigt vom Jüngsten Gericht: Da lässt er einen eben Gestorbenen auftreten und die Qual des Sterbens beschreiben, die Teufel debattieren am Totenbett über ihren Anspruch auf die Seele, und Gott selbst fordert den armen Sünder zur Rechenschaft auf, was der Prediger wiederum mit beschwörenden Mahnungen an die Zuhörer kommentiert. Berthold-Experten sind sicher, dass er solche Reden wie ein Schauspieler vorgetragen hat, die einzelnen Rollen mit unterschiedlichen Stimmlagen und dramatischen Gesten verkörpernd.

Mancher läuft hin nach (Santiago de) Compostela zu Sankt Jakob (…). Nun, was findest du in Compostela? Da findest du Sankt Jakobs Haupt. Das ist sehr gut; doch ist es ein toter Schädel, der bessere Teil ist im Himmel. Nun, was findest du hier zu Hause bei deinem Hofzaun? Wenn du morgens in die Kirche gehst, dann findest du den wirklichen Gott!“
Und dann diese Fülle von Bildern! Wunderschön illustriert Berthold den Glaubenssatz von der Auferstehung der Toten: „In der Auferstehung wird die Seele einen Leib haben, lichter als der Sonnenschein, schneller als der Augenblick, beweglicher als die Luft.“
Die ziemlich abstrakte Lehre von der Dreifaltigkeit erklärt er so, dass ja auch Friedrich II. gleichzeitig römischer Kaiser, König von Deutschland und Herzog von Schwaben sei, ein und derselbe Mensch, der lediglich verschiedene Funktionen ausübe. Genauso seien Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht drei Götter, sondern ein einziger Gott.
Und dann geht die Kanzelrede auf einmal in ein fast intimes Zwiegespräch mit einem armen Sünder über, der Franziskaner greift fiktive Einwände auf, stellt kritische Fragen und gibt sogleich selbst die Antwort, oder er wendet sich direkt an irgendeine Gestalt aus der Bibel oder ruft die Engel oder auch die Teufel zu Zeugen an. Er kann sanft schmeicheln, besonders wenn er die Frauen anspricht, die gewiss lieber beten als die Männer – und er kann dreinfahren wie ein Fuhrknecht: „Pfui Kupplerin, du Lockpfeife des Teufels, damit er manche Seele fängt!“ – „Pfui Fresser!“ – „Pfui Geizhals, wie hart dein Amen vor Gottes Ohren, wie Hundegebell!“
Anders als viele todernste Bußprediger seiner Epoche verfügt Bruder Berthold über einen bärbeißigen Humor. Die triviale Vorstellung, Gott sitze in seliger Muße droben im Himmel und lasse die Beine auf die Erde herunterbaumeln, pariert er mit dem Seufzer: „O weh, lieber Gott, da müsstest du lange Hosen haben!“ Den alten Leuten wirft er gern an den Kopf, sie sollten sich bloß nichts einbilden auf ihre Tugendhaftigkeit; zu Sünden wider die Keuschheit seien sie schlicht nicht mehr rüstig genug: „Ihr altes Gebein hat ausgehüpft, und jetzt denken sie daran, was sie in der Dummheit getan haben, und bereuen es oft mehr, als billig und ziemlich wäre.“
Warum gibt es so viele Arme?
Mit seiner Realistik, seinem aufmerksamen Blick für die Alltagswelt erhebt sich der Prediger Berthold weit über den Durchschnitt seiner Kollegen, die sich in der Regel auf das saft- und kraftlose Herbeten der Kirchenväter beschränkten. Darum waren die Germanisten um Jacob Grimm hell begeistert, als sie diese frische, unverwechselbare Stimme vor zweihundert Jahren wiederentdeckten.
Umso größer der Schock, als sich Bertholds Prosa als Produkt irgendwelcher anonymer Bearbeiter entpuppte. Die hatten aus den überlieferten lateinischen Predigtfassungen deutsche Übersetzungen gefertigt – mit den Eigenmächtigkeiten und Unschärfen, die zu erwarten sind, wenn von einem mittelalterlichen Wanderprediger lediglich verstreute Redensammlungen existieren, und wenn er selbst sich über schlampige Nachschriften beschwert, aber keine autorisierte, letztgültige Ausgabe vorgelegt hat. Man weiß außerdem, dass er mit Vorliebe improvisierte und sich keineswegs an die eigenen Entwürfe hielt. Die 263 über Europa verstreuten Handschriften mit seinen lateinischen Predigten sind Rekonstruktionen, und die deutschen Sammlungen sind wiederum nachträgliche Bearbeitungen dieser Rekonstruktionen.
Sei’s drum, Bruder Bertholds Botschaft ist zeitlos: Christsein, wie er es in seiner von Gewalt und Unrecht geprägten Epoche versteht, ist eine sehr praktische Sache. Reue und Buße müssen Folgen haben, auch soziale. Die Entscheidung für Christus muss das alltägliche Leben verändern, sonst bleibt sie fromme Heuchelei. Wobei Berthold keineswegs nur mit der Hölle droht, sondern eindringlich Gottes leidenschaftliche Liebe zu den Menschenkindern verkündet. Statt ihn ebenso stürmisch wiederzulieben und den Himmel erobern zu wollen, geben die sich aber mit dem bequemsten Weg zufrieden: „Lehre uns, wie wir gemächlich in das Himmelreich kommen!“, mokiert er sich über seine trägen Zuhörer und vergleicht sie mit Kriechtieren.
Wozu ist der Mensch denn auf der Welt? Um Gott lieb zu haben und seine Seele zu bewahren. Barmherzig sollen sie miteinander umgehen, seine Zuhörer. Ein Ehemann darf seine Frau nicht einfach beschimpfen und verprügeln, weil sie ihm untertan zu sein habe, „denn sie hat Gott in ihrem Herzen und deshalb soll sie dir gleich sein.“ Und nur deshalb gibt es so viele Arme, weil die Reichen prassen und saufen und im Luxus leben wollen.
Den Umsturz predigt Berthold nicht – wer tat das damals schon? Aber eine Bekehrung, die auch die Spitzen der Gesellschaft und der kirchlichen Hierarchie nicht ausspart. Seine ungeheure Popularität ermöglicht es dem Franziskaner, dem Kaiser und den Fürsten, den hohen Prälaten und dem Papst in Rom einen Spiegel vorzuhalten. „Herr Papst, wärt Ihr hier …!“, pflegt er solche Standpauken zu beginnen. „Herr Papst, wärt Ihr hier, ich getraute mich wohl, Euch zu sagen: Alle die Seelen, die Ihr dem allmächtigen Gott zugrunde richtet oder die durch Eure Schuld verloren gehen, sofern Ihr’s abwenden solltet und könntet, die müsst Ihr Gott erstatten zu Eurem großen Schaden.“
Читать дальше