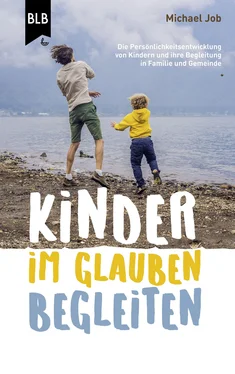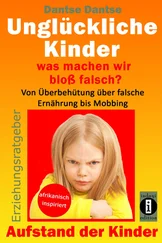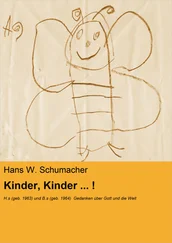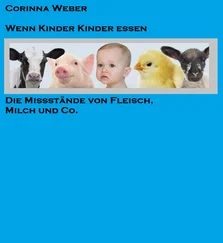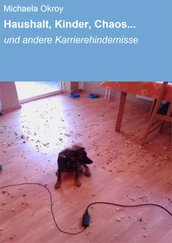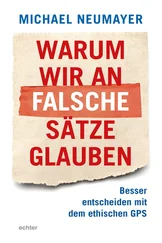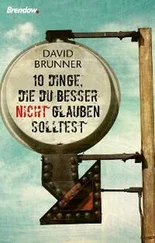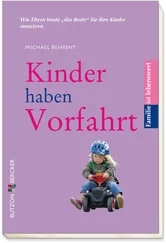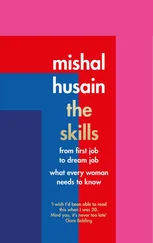„Es ist so schwer zu glauben“, schreibt die 13-jährige Carmen unter den Fragebogen, den sie soeben in der Teenagergruppe ausgefüllt hat. Sie sollte die Dinge aufschreiben, die uns darin hindern, einen eigenen Glauben zu entwickeln. Es fiel ihr nicht schwer, etliche Hindernisse zu notieren.
„Glaubst du auch an Jesus?“, fragt der fünfjährige Felix die Großtante, die zu Besuch gekommen ist. „Nein“, antwortet die Tante und fragt zurück: „Warum sollte ich das denn?“ Felix im Brustton der Überzeugung: „Weil das besser für dich wär’.“
Während einer Freizeit sucht Jonas das Gespräch mit mir. Nach dem Mittagessen hat er mich gefragt, ob ich Zeit für ihn hätte. Nun eröffnet mir der 15-Jährige, dass er endlich „ganze Sache“ mit Jesus machen möchte und „das viele Hin und Her“ leid wäre. Im Gebet formuliert er, dass er mit seiner ganzen Person, mit allem, was ihn ausmacht, Jesus nachfolgen will.
Kinder jeden Alters machen ihre Erfahrungen mit Gott. Diese Erfahrungen sind vielfältig und unterschiedlich. Sie handeln von unerschütterlicher Gewissheit und großen Zweifeln, es geht um Lügen, Stehlen und Wiedergutmachen, um Freundschaft zu Gott, Beziehungen zu anderen und um Nachfolge Jesu. Dies alles umso mehr, wenn die Kinder in christlichen Elternhäusern von klein auf mit Glaubensinhalten vertraut gemacht worden sind oder in einem gemeindlichen Umfeld aufwachsen.
Wie aber entwickelt sich der Glaube eines Kindes? Welche Rolle spielt dabei seine körperliche, soziale, intellektuelle oder emotionale Entwicklung? Und wie können wir Kindern in den jeweiligen Phasen helfen, Glaubensschritte zu gehen, ohne sie zu überfordern oder gar zu manipulieren? Diesen Fragen soll in diesem Buch nachgegangen werden.
Im Mittelpunkt steht das Kind, das uns in der gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit anvertraut ist. Die Betrachtungen beginnen mit dem zweijährigen Kind, das sich erstmals (und meist nur kurzzeitig) ohne Eltern in einer Gruppe, wie z. B. dem Kindergottesdienst, zurechtfindet. Sie enden im Jugendalter von etwa 17 Jahren nach Abklingen der Pubertät. Die Säuglingsphase wird nur kurz angerissen.
Innerhalb dieser Altersspanne wollen wir die einzelnen Entwicklungsstufen genauer betrachten. Ziel dabei ist es, den Kindern in ihrer jeweiligen Lebensphase ein Stück „unter die Haut zu kriechen“, um ihr Denken und Fühlen besser verstehen und daraus Rückschlüsse für das pädagogische Handeln ziehen zu können.
Maßgeblich ist dabei der Blickwinkel der Eltern und Kindermitarbeiter. Ihnen sollen diese Ausführungen als Hilfestellung im Familien- und Gemeindealltag dienen. Eltern und Mitarbeiter stehen in der Gemeinde in einer gemeinsamen Herausforderung: das anvertraute Kind in sozialer, emotionaler und intellektueller Hinsicht zu fördern, ihm zu helfen, seine Begabungen zu entfalten und seine Fähigkeiten zu erweitern. Diese Erziehungsziele decken sich mit denen von Kindertageseinrichtungen oder Schulen. Darüber hinaus aber verbindet Mitarbeiter und Eltern in der Gemeinde ein weiteres Anliegen: Sie haben den Wunsch und das erklärte Ziel, das Kind auf seinem Weg des Glaubens zu begleiten.
Dazu müssen Eltern und Gemeinde zum Wohl des Kindes partnerschaftlich zusammenarbeiten. Die Verantwortung für die religiöse Erziehung der Kinder liegt bei den Eltern. Sie entscheiden, wie und in welchem Umfang diese Erziehung stattfindet. Gemeinde will und soll Eltern bei der religiösen Erziehung unterstützen. So wie derzeit vielfach von „Erziehungspartnerschaften“ oder „Bündnissen für Erziehung“ die Rede ist, so müssen sich auch Gemeinde und Eltern als Verbund verstehen. Die religiöse Erziehung des Kindes sollte in einem Bündnis zwischen Eltern und Gemeinde geschehen.
Als verbindende Zielvorgabe können die Worte aus 5. Mose 6,4-9gelten:
Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein! Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. (Elberfelder Bibel)
Den Auftrag Gottes an das Volk Israel wollen auch wir uns zu eigen machen. Wir wünschen uns, dass immer mehr Kinder und Jugendliche Gott von ganzem Herzen lieb gewinnen, und zwar mit ganzer Seele und all ihrer Kraft. Darum wollen wir die Kinder in Glaubensfragen unterweisen und begleiten. Die Anforderungen an uns selbst sind nicht gering: Wir sollen diese Worte zuallererst selbst beherzigen und erst dann unseren Kindern weitersagen und sogar einschärfen. Die Liebe zu Gott soll unseren häuslichen Alltag („wenn du in Deinem Hause sitzt“) und unser öffentliches Auftreten („wenn du auf dem Weg gehst“) bestimmen. Sie soll gleichermaßen unsere Nächte und Tage, ja unser ganzes Leben durchdringen. Zuletzt gibt Gott selbst uns kreative Ideen zur pädagogischen Vermittlung seiner Worte.
Um den Auftrag zu erfüllen, hilft es, die verschiedenen Stufen der Entwicklung eines Kindes ernst zu nehmen. Andernfalls laufen Eltern und Kindermitarbeiter Gefahr, dass das Kind eine Botschaft ihnen zuliebe annimmt, die es nicht verstanden hat. Oder aber Kinder scheinen vordergründig unsere Lehre zu akzeptieren – in Wirklichkeit aber haben sie nur keinen Raum für ihre Fragen und Zweifel. Darum müssen wir sorgsam die Entwicklungsprozesse betrachten. Sie helfen uns, Kinder und Teenager besser in ihrem Wesen zu verstehen und sie in ihrer Glaubensentwicklung zu begleiten.
[no image in epub file]
© Prixel Creative – Lightstock.com
Die Entwicklungsstufen des Kindes und mögliche Glaubensschritte
Es gibt viele unterschiedliche Theorien über menschliche Entwicklungsstufen. Mal wird stärker der kognitive Aspekt betrachtet (Jean Piaget), mal die psycho-soziale Komponente (Erik H. Erikson), mal geht es um die Entwicklung der Moral (Lawrence Kohlberg) oder um klassisch-psychologische Betrachtungen (Sigmund Freud). Alle diese Theorien lassen den Glaubensaspekt außer Acht.
Erst seit den Siebzigerjahren haben sich vermehrt auch Theologen der Entwicklungspsychologie genähert und die Glaubensentwicklung betrachtet (z. B. James W. Fowler1, Michael Job, James Loder2, John Westerhoff3). Im deutschsprachigen Raum haben u. a. Hans-Jürgen Fraas4 und Karl Ernst Nipkow5 über Religionspädagogik und entwicklungspsychologische Themen gearbeitet. Autoren wie Frank und Catherine Fabiano6 oder Francis Bridger7 haben auf Grundlage dieser Theorien ihre seelsorgerlichen oder theologischen Akzente gesetzt.
Der Ansatz in diesem Buch ist in erster Linie pädagogischer Natur. Wir wollen die verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes betrachten, um Rückschlüsse für den Umgang in der Familie und für die Arbeit in unseren Gemeinden zu ziehen. Dabei wollen wir uns in jeder Phase fragen, wie uns dieses Wissen helfen kann, das Kind und den Jugendlichen in seiner Glaubensentwicklung zu begleiten. Meine Erkenntnisse stützen sich im Wesentlichen auf meine Beobachtungen und Schlüsse, die ich in der Kinder- und Jugendarbeit gezogen habe, und auf die Ausführungen von Fabiano und Bridger (s. o.) zu diesem Thema.
Eines ist dabei wichtig: Immer wenn es um Entwicklungen bei Menschen geht, kann man lediglich Tendenzen aufzeigen. Denn schließlich lebt der Mensch nicht nach theoretischen Entwicklungsstufen. Diese sind ja zuvor aufgrund von Beobachtungen festgelegt worden. Dazu wird eine möglichst große Gruppe von Gleichaltrigen betrachtet und die Entwicklungen, die bei der Mehrzahl ähnlich verlaufen, werden wissenschaftlich erfasst und systematisch geordnet. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass es immer auch Ausnahmen, Verschiebungen und Entwicklungsverzögerungen geben kann. Die Altersangaben dienen lediglich zur Orientierung.
Читать дальше