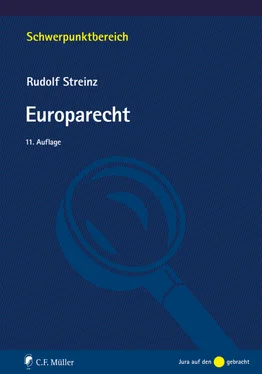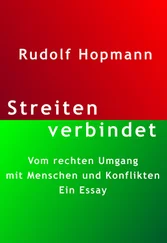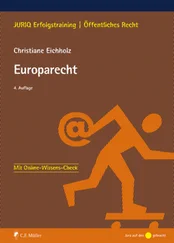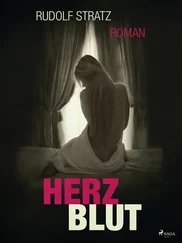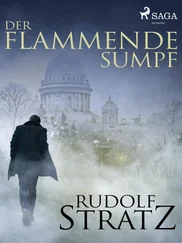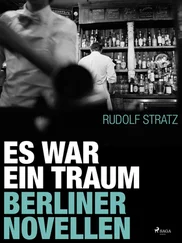84
Bereits die erste Bewährungsprobe des KSZE-Mechanismus, der sog. „Bürgerkrieg“ zwischen Kroatien und Serbien (1991), hat die derzeitig mangelnde Eignung der KSZE für eine Lösung wirklicher Konflikte offenbart. Gleiches gilt für die folgenden Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, in Tschetschenien (seit 1995), zuletzt zwischen Russland und der Ukraine nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim[99]. Das unter Einbeziehung Deutschlands und Frankreichs vereinbarte Waffenstillstandsabkommen von Minsk hinsichtlich der Kampfhandlungen in der Ostukraine wird nicht eingehalten, die Beobachter der OSZE werden behindert. Die erfolgte bloße Umbenennung in „ Organisation über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ ( OSZE, vgl Rn 15) kann daran nichts ändern. Von einem System echter kollektiver Sicherheit ist Europa nach wie vor weit entfernt, vor allem wegen der zuletzt deutlichen Verschlechterung der Beziehungen zu Russland. Dieses aufzubauen ist ua deshalb so schwierig, weil es das Vertrauen der Beteiligten, so sie sich darauf überhaupt einlassen wollen, in seine allein an objektiven Kriterien orientierte Anwendung voraussetzt.
§ 2 Entwicklung und Stand der Europäischen Integration› V. Gesamteuropäische Perspektiven und Organisationen › 4. Verbindung von Europäischer Gemeinschaft bzw Union und EFTA-Staaten zu einem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
4. Verbindung von Europäischer Gemeinschaft bzw Union und EFTA-Staaten zu einem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
85
Nach langen und zähen Verhandlungen ist es am 14.2.1992 gelungen, eine Übereinkunft zwischen der Europäischen Gemeinschaft (EG) und ihren Mitgliedstaaten und den EFTA-Staaten über einen „Europäischen Wirtschaftsraum“ (EWR-Vertrag)[100] zu treffen, die zum 1.1.1993 in Kraft treten sollte. Diese bedurfte aber der Ratifikation durch alle beteiligten Staaten, die wiederum die Zustimmung der nationalen Parlamente, zum Teil zudem Volksabstimmungen voraussetzte. Im Gegensatz zu Liechtenstein ging in der Schweiz das EWR-Referendum negativ aus (50,3% Nein gegen 49,7% Ja bei 78,3% Beteiligung)[101]. Die dadurch erforderlichen Vertragsanpassungen verzögerten das Inkrafttreten um ein Jahr auf den 1.1.1994. Seither sind grundsätzlich die Grundfreiheiten des EGV (jetzt AEUV) auf den EWR ausgedehnt. Gemeinsame Organe (vgl zu den Organen Art. 89–95, zu ihren und den Tätigkeiten von EFTA-Überwachungsbehörde und EFTA-Gerichtshof Art. 105–111 EWR-Vertrag) sollen eine Abstimmung zwischen EWR und EG (jetzt EU als Rechtsnachfolgerin) bringen. Dies kann natürlich nicht eine Beteiligung an der EU-Rechtssetzung ersetzen, weshalb Schweden, Österreich und Finnland der Europäischen Union beigetreten sind. Bemerkenswert ist die Beteiligung der EFTA-Staaten an der Finanzierung von EU-Regionalprogrammen. S. zum EWR auch Rn 1289.
§ 2 Entwicklung und Stand der Europäischen Integration› V. Gesamteuropäische Perspektiven und Organisationen › 5. Partnerschaftsabkommen – Assoziierung der Balkanstaaten
5. Partnerschaftsabkommen – Assoziierung der Balkanstaaten
86
Mit dem Beitritt nahezu aller mittel- und osteuropäischen Staaten (MOE-Staaten) hat der insbesondere auf der Grundlage der Assoziationsabkommen (Europa-Abkommen)zwischen der EG und diesen Staaten beruhende Annäherungsprozess seinen erfolgreichen Abschluss gefunden[102]. Zu Assoziationsabkommen der EU s. Rn 1285 ff.Mit den osteuropäischen Staaten und vorderasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken, die – ungeachtet ihrer eigenen dahingehenden Wünsche – für einen Beitritt aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht kommen, wurden spezielle Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeitgeschlossen (mit Armenien, Aserbaidschan, Belarus (Weißrussland), Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, der Republik Moldau, der Russischen Föderation, der Ukraine[103] und Usbekistan)[104]. Im Unterschied dazu betrachtet die Europäische Union seit dem Europäischen Rat von Feira im Jahr 2000 die Staaten des westlichen Balkanslangfristig als potenzielle Kandidaten für einen Beitritt[105] und hat dies auf dem Europäischen Rat von Thessaloniki 2003 bestätigt[106]. Bisheriger Kernbestandteil der Strategie für den westlichen Balkan ist der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess(SAP), durch den die Reformbestrebungen in den Balkanstaaten gestärkt, diese politisch stabilisiert und politisch wie wirtschaftlich an die EU herangeführt werden sollen. Dabei folgt die Konzeption des SAP weitgehend der Erweiterungsstrategie der EU im Hinblick auf die MOE-Staaten. Die Grundlage bilden die mit den einzelnen Staaten der Region (Kroatien, jetzt Mitglied der EU; Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien; zum jeweiligen Status s. Rn 71) abgeschlossenen Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen sowie das begleitende Programm zur finanziellen Unterstützung des Reformprozesses (CARDS).
Literatur:
Beichelt, T ., Die Politik der Östlichen Nachbarschaft – inkompatible Grundannahmen und antagonistische Herausforderung, integration 2014, 357; von Bogdandy, A . (Hrsg.), Die Europäische Option, 1993; Dauses, M . (Hrsg.), Osterweiterung der EU, 1998; Gierig, C ., Europa zwischen Zweckverband und Superstaat. Die Entwicklung der politikwissenschaftlichen Integrationstheorie im Prozess der europäischen Integration, 1997; Häberle, P ., Europäische Rechtskultur. Versuch einer Annäherung in zwölf Schritten, 1994; Hummer, W ., Sonderbeziehung EG-EFTA, in: Dauses/Ludwigs, K. III (EL 6/1999); Loth, W ., Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte, 2014; Schlotter, B ., Die OSZE – Leistungsfähigkeit einer internationalen Organisation, Die Friedens-Warte 75 (2000), S. 11 ff; Schweisfurth, T ., Die juristische Mutation der KSZE – Eine internationale Organisation in statu nascendi, in: FS Bernhardt, 1995, S. 213 ff; Streinz, R ., Einführung: 50 Jahre Europarat, in: ders . (Hrsg.), 50 Jahre Europarat: Der Beitrag des Europarates zum Regionalismus, 2000, S. 17 ff; Streinz, T. , Fraternal Twins: The European Union and the Council of Europe, in: de Waele, H./Kuipers, J.-J. (Hrsg.), The European Union’s Emerging International Identity, 2013, S. 101; Tretter, H ., Von der KSZE zur OSZE, EuGRZ 1995, 296; Verny, A ., Die Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, in: Dauses/Ludwigs, K. IV (EL 43/2017). Ferner die Beiträge in EuR Beiheft 1/1994 und 1/2000.
[1]
Assyrisch „ereb“ (Dunkel, Abendland) gegenüber „açu“ (Sonnenaufgang, Morgenland: Asien); Sage der von Zeus entführten Tochter „Europa“ des Königs Agenor. Eingehend zum Ursprung des Europabegriffs W. Schmale , Geschichte Europas, 2000, S. 21 ff.
[2]
Gemäß Art. I-8 Abs. 2 EVV sollte der Leitspruch der Europäischen Union lauten: „In Vielfalt geeint“. Der Artikel über die Symbole wurde ausdrücklich nicht in den Vertrag von Lissabon übernommen (vgl Rn 61); sie können in der Praxis natürlich weiterhin verwendet werden. Vgl dazu die Erklärung Nr 52 zur Schlussakte zum Vertrag von Lissabon zu den Symbolen der EU (ABl 2007 C 306/267; ABl 2012 C 326/357; Sart. II Nr 152), die allerdings nur 16 der damals 27 Mitgliedstaaten abgegeben haben.
[3]
Sart. II Nr 100. S. dazu Rn 1.
[4]
Sart. II Nr 65.
[5]
Sart. II Nr 70. Vgl dazu Oppermann/Classen/Nettesheim , § 4, Rn 3 ff.
[6]
Vgl BullBReg 1994, S. 1097. Zur Struktur der OSZE vgl Fastenrath , Einführung, S. 23 ff.; Dokumente der OSZE ebd.
[7]
Gemäß Art. I-8 Abs. 5 EVV sollte als „Europatag“ in der gesamten Union der 9. Mai (1950: Schuman-Erklärung) gefeiert werden.
Читать дальше