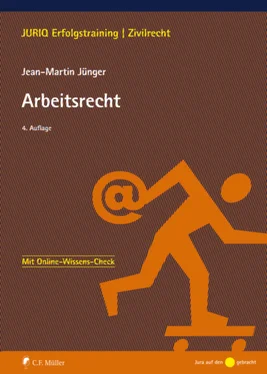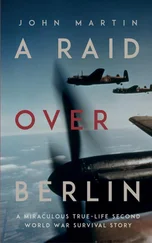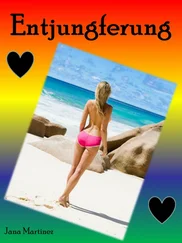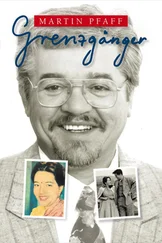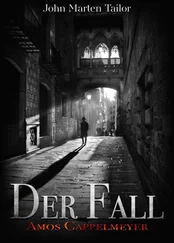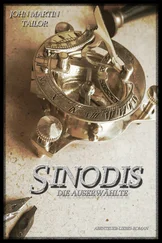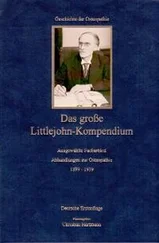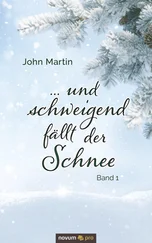2. Verfolgung eines arbeitstechnischen Zwecks
67
Dieses Merkmal dient der Abgrenzung des Betriebs vom Unternehmen an sich, das üblicherweise einen wirtschaftlichen oder ideellen Zweck verfolgt. Der Betrieb ist gewissermaßen dazu da, den wirtschaftlichen Zweck des Unternehmens voranzutreiben. Dies kann nach Ansicht des BAG negativ abgrenzt werden.[15] Zu prüfen ist daher, ob der zu untersuchende Teil des Unternehmens nur Hilfsfunktionen erfüllt (so z.B. eine Kantine, die die Versorgung der Arbeitnehmer sicherstellen soll) oder mittelbar dazu beiträgt, dass das Unternehmen wirtschaftliche Erfolge erzielen kann (z.B. Versandabteilung). Nur im letzteren Fall ist von einem Betrieb auszugehen.
68
Die Frage nach dem Vorhandensein oder der Art von Betriebsmitteln sollte nicht gesondert geprüft werden. In der Regel wird wenigstens ein Mittel materieller oder immaterieller Art eingesetzt werden, um den arbeitstechnischen Zweck zu verfolgen. Eine besondere Erwähnung dieses Umstands erscheint nicht notwendig. Wichtig ist vielmehr, dass die vorhanden Mittel „für den oder die verfolgten arbeitstechnischen Zwecke zusammengefaßt, geordnet und gezielt eingesetzt werden“ [16] , was allerdings eher unter den Prüfungspunkt „Einheit“ passt.
2. Teil Individualarbeitsrecht› A. Grundbegriffe› VIII. Betriebsrat
69
Der Betriebsrat ist – obwohl das Recht des Betriebsrats als Kollektivorgandem kollektiven Arbeitsrecht zuzuordnen ist – auch im Individualarbeitsrecht von entscheidender Bedeutung. Der Betriebsrat fungiert als gesetzlicher Interessenvertreternicht nur der gesamten Arbeitnehmerschaft,[17] sondern auch des einzelnen Arbeitnehmers (z.B. als Ansprechpartner für Beschwerden nach § 85 BetrVG).
1. Betriebsratsfähigkeit des Betriebs
70
Nach § 1 Abs. 1 BetrVG kann in Betrieben und Unternehmen ab einer Größe von mindestens fünf ständig wahlberechtigten Arbeitnehmern, wovon drei wählbar sind, ein Betriebsrat gewählt werden. Wie die Formulierung als „Kannvorschrift“ verrät, besteht keine Betriebsratspflicht.
Die Organisation der Erstwahl kann von einem Gesamt- oder Konzernbetriebsrat oder der Betriebsversammlung initiiert werden, § 17 BetrVG. Die weiteren Wahlen organisiert in der Regel der amtierende Betriebsrat, § 16 BetrVG. Wahlen finden gem. § 13 Abs. 1 BetrVG alle vier Jahre statt.
71
Wählbarzum Betriebsrat, also passiv wahlberechtigt, sind Arbeitnehmer, die dem Betrieb länger als sechs Monate angehören oder eine entsprechende Zeit lang in Heimarbeit für den Betrieb tätig waren, § 8 Abs. 1 S. 1 BetrVG. Zeiten in einem anderen Betrieb des Unternehmens oder Konzerns werden dabei gem. § 8 Abs. 1 S. 2 BetrVG angerechnet. Die Wählbarkeit verliert, wem nach strafrechtlichen Grundsätzen das Wahlrecht aberkannt wurde, § 8 Abs. 1 S. 3 BetrVG.
72
Wählendürfen gem. § 7 BetrVG alle Arbeitnehmer ab dem 18. Lebensjahr, außerdem Leiharbeitnehmer, wenn sie über drei Monate im Betrieb eingesetzt werden.
73
Die Größe des Betriebsratsgremiums bestimmt sich nach § 9 BetrVG nach der Anzahl der dem Betrieb angehörenden Arbeitnehmer. In Betrieben mit zum Beispiel fünf bis 20 Arbeitnehmern besteht der Betriebsrat demnach aus nur einem Mitglied. Ab einer Arbeitnehmerzahl von 200 Arbeitnehmern ist eine bestimmte Zahl von Betriebsratsmitgliedern vollständig von ihrer Arbeitspflicht zu befreien. Diese freigestelltenBetriebsräte können sich ganz ihrer Tätigkeit als Interessenvertreter widmen, ohne gleichzeitig ihren Aufgaben in der Produktion oder Verwaltung usw. nachgehen zu müssen.
Hinweis
Das genaue Wahlverfahren und die Wahlanfechtung gehören eher selten zu den Prüfungsthemen, weswegen im Rahmen dieses Skripts keine weiteren Ausführungen dazu gemacht werden. Sie sollten die einschlägigen Vorschriften (§§ 13–20 BetrVG) trotzdem vor der Klausur wenigstens einmal durchlesen.
2. Aufgaben des Betriebsrates
74
Wie bereits angedeutet, vertritt der Betriebsrat die Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, steht also im Arbeitnehmerlager. § 80 Abs. 1 BetrVG enthält einen Katalog, der die allgemeinen Aufgaben des Betriebsrats näher beschreibt. Das BetrVG enthält darüber hinaus Spezialaufgaben des Gremiums, welche in Rn. 520 ff.näher beschrieben werden.

Online-Wissens-Check
Wissen Sie noch, was man unter einem „Betrieb“ versteht?
Überprüfen Sie jetzt online Ihr Wissen zu den in diesem Abschnitt erarbeiteten Themen.
Unter www.juracademy.de/skripte/login steht Ihnen ein Online-Wissens-Check speziell zu diesem Skript zur Verfügung, den Sie kostenlos nutzen können. Den Zugangscode hierzu finden Sie auf der Codeseite.
[1]
Wiederholen Sie hierzu die Ausführungen im Skript „BGB AT I“.
[2]
Vgl. Rn. 155 ff.
[3]
BAGE 115, 1-11; vgl. auch NZA 2015, 1032-1041; BAG NZA-RR 2016, 288-291.
[4]
BAG DB 1979, 1186 f.
[5]
BAGE 115, 1-11.
[6]
BAGE 115, 1-11.
[7]
BAG NZA 1998, 705 ff.
[8]
Nach LAG Hamm Urteil vom 10.1.2013, Az.: 15 Sa 1238/12, juris.
[9]
Nach BAG NZA-RR 2007, 424 ff.
[10]
BAG NZA 1999, 539.
[11]
BAGE 122, 225-234.
[12]
BAG 1, 175.
[13]
BAG NZA 2004, 1380-1383.
[14]
BAG NZA 2010, 671-272.
[15]
BAG 85, 291-306.
[16]
BAG 59, 319-328.
[17]
Vgl. dazu etwa § 80 Abs. 1 BetrVG.
2. Teil Individualarbeitsrecht› B. Die Anbahnung und Begründung eines Arbeitsverhältnisses
B. Die Anbahnung und Begründung eines Arbeitsverhältnisses
75
Die ersten Kontakte zwischen dem Bewerber und seinem potenziellen Arbeitgeber kommen oft dadurch zustande, dass der Arbeitnehmer sich auf eine Stellenanzeige des Arbeitgebers hin bewirbt.
Hinweis
Auch hier gelten die allgemeinen Regeln des BGB AT. Das Stellenangebot des Arbeitgebers stellt mangels Rechtsbindungswillen nur eine unverbindliche invitatio ad offerendum dar.
Zu beachten ist, dass ein Schuldverhältnis i.S.d. § 280 BGB nach § 311 Abs. 2 BGB auch durch die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, die Anbahnung eines Vertrages oder ähnliche geschäftliche Kontakte entsteht. Nach § 241 Abs. 2 BGB sind die Parteien zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. Eine schuldhafte Verletzung dieser Rücksichts- und Interessenwahrungspflichten löst Schadensersatzansprüche nach §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 (c.i.c) aus.[1]
2. Teil Individualarbeitsrecht› B. Die Anbahnung und Begründung eines Arbeitsverhältnisses› I. AGG-Schutz des Arbeitnehmers
I. AGG-Schutz des Arbeitnehmers
76
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) spielt in Klausuren an dieser Stelle oft eine wichtige Rolle. Das Gesetz verbietet die Diskriminierung durch Arbeitgeber vor, während und auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses und setzt mitunter strenge Rechtsfolgen für den Fall des Verstoßes, vgl. Rn. 19 ff.
Lesen Sie zunächst §§ 1–3, 6–11 AGG, um mit den Vorschriften vertraut zu werden.
In der Prüfung bietet sich die Orientierung an folgenden Punkten an:
Schutz vor Benachteiligung
I. Persönlicher (§ 6 AGG) und sachlicher Anwendungsbereich (§ 2 AGG)
Читать дальше