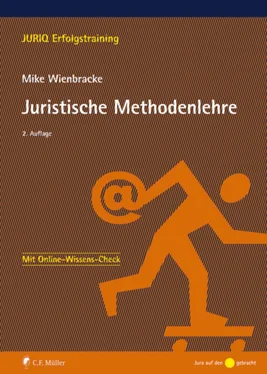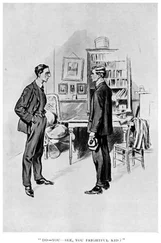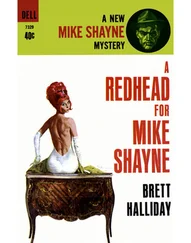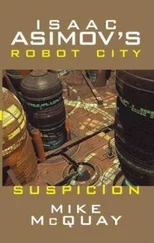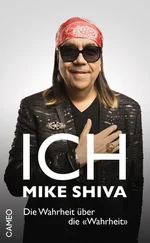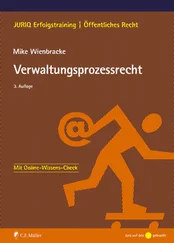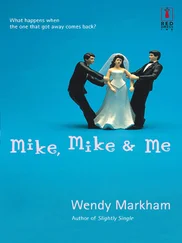[6]
Staake , Jura 2011, S. 177 (178) m.w.N.; ders ., Jura 2018, S. 661 (665).
[7]
Vogel , Methodik, S. 68.
[8]
Beaucamp/Beaucamp , Methoden, Rn. 46; Muthorst , Grundlagen, § 5 Rn. 29; Schwacke , Methodik, S. 22, 25; Vogel , Methodik, S. 68 mit dem Hinweis, das von diesem Verständnis des Tatbestands im „methodischen Sinn“ die im Besonderen Teil des StGBvertypten Unrechtstatbestände (z.B. § 263 Abs. 1 StGB: Betrug) sowie der prozessrechtliche Begriff des Tatbestands, welcher sich in § 313 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 ZPO, § 117 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 VwGO im Wesentlichen auf den Sachverhalt bezieht, zu unterscheiden sind.
[9]
Wank , Auslegung, S. 6 a.E. Vgl. auch Vogel , Methodik, S. 71.
[10]
Vgl. Beaucamp/Beaucamp , Methoden, Rn. 60 m.w.N. Zum nachfolgenden Schaubild vgl. dies. , a.a.O., Rn. 67; Muthorst , Grundlagen, § 5 Rn. 38; Schmalz , Methodenlehre, Rn. 15.
[11]
Zippelius , Methodenlehre, S. 23 unter Hinweis auf Luhmann , Rechtssoziologie, 2. Aufl. 1983, S. 88, 227 ff. Demgegenüber ist der Zusammenhang zwischen Tatbestand und Rechtsfolge bei Final-bzw. Zwecknormen(z.B. § 1 Abs. 7 BauGB) allenfalls lose, siehe Lepsius , JuS 2019, S. 123 (127).
[12]
Butzer/Epping , Arbeitstechnik, S. 17; Muthorst , Grundlagen, § 5 Rn. 29 ff.; Zippelius , Methodenlehre, S. 25.
[13]
Adomeit/Hähnchen , Rechtstheorie, Rn. 86; Mann , Einführung, Rn. 207, dort auch zu mitunterbestehenden zwingenden Vorgaben bzgl. der Prüfungsreihenfolge; Schwacke , Methodik, S. 62, 64; Wank , Auslegung, S. 11, 13; Zippelius , Methodenlehre, S. 27. Die Prüfung der Tatbestandsmerkmale in der gesetzlichen Reihenfolgegebietet lediglich eine „Faustformel“, siehe Vahle , DVP 2012, S. 2 (10).
[14]
Hierzu siehe im Skript „Allgemeines Verwaltungsrecht“, Rn. 40 ff. m.w.N.
[15]
Wank , Auslegung, S. 47. Dort und bei Rüthers/Fischer/Birk , Rechtstheorie, Rn. 931 ff. auch zur Kritikam Typusbegriff. Zur Unterscheidung zwischen Regeln und Rechtsprinzipiensiehe Rn. 115.
[16]
Röhl/Röhl , Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl. 2008, S. 616.
[17]
Butzer/Epping , Arbeitstechnik, S. 29 f.; Vogel , Methodik, S. 67.
[18]
Leenen , Typus und Rechtsfindung, 1971, S. 34 m.w.N.
[19]
Butzer/Epping , Arbeitstechnik, S. 30.
[20]
Zippelius , Methodenlehre, S. 16.
[21]
Zum Ganzen siehe Larenz/Canaris , Methodenlehre, S. 294, 297.
[22]
Von engl. „ fuzzy“ = „verschwommen“. Hierzu siehe etwa Muthorst , Grundlagen, § 4 Rn. 34.
[23]
Röhl/Röhl , Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl. 2008, S. 616.
[24]
Röhl/Röhl , Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl. 2008, S. 616 f. Dort (S. 618) auch zu dem von Bender , in: GS Rödig, 1978, S. 34 entwickelten, in BGHZ 80, 153 (159 f.) bzgl. gesetzlicher Tatbestandsmerkmale jedoch verworfenen sog. „ Sandhaufen-Theorem“.
[25]
Larenz/Canaris , Methodenlehre, S. 297 ff.; Vogel , Methodik, S. 147. Hierbei handelt es sich nichtum eine Methode der Subsumtion, siehe Zippelius , Methodenlehre, S. 61.
[26]
BVerfGE 145, 171 (193) m.Anm. Wienbracke , BB 2017, S. 1832 (Hervorhebungen d.d. Verf.).
[27]
Vgl. Beaucamp/Beaucamp , Methoden, Rn. 53, 56, 64 f.; Schwacke , Methodik, S. 23.
[28]
Zum Ganzen siehe Börner , Jura 2014, S. 1258 (1259); Rüthers/Fischer/Birk , Rechtstheorie, Rn. 116; Vogel , Methodik, S. 71; Zippelius , Methodenlehre, S. 3 f. Siehe auch Rn. 6.
[29]
Zu den erst durchdie Rechtsprechungbzw. Literatur entwickelten Voraussetzungen siehe Mann , Einführung, Rn. 251.
[30]
Adomeit/Hähnchen , Rechtstheorie, Rn. 83; Beaucamp/Beaucamp , Methoden, Rn. 64; Schmalz , Methodenlehre, Rn. 96, 543; Wank , Auslegung, S. 13.
[31]
Vgl. Vogel , Methodik, S. 68; Wank , Auslegung, S. 19; Zippelius , Methodenlehre, S. 4, 25. Da im „Restaurant-Fall“( Rn. 2) keine Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Verhalten des A vorliegen, hat er sich durch Umstoßen der Designerlampe nicht gem. § 303 Abs. 1 StGB strafbar gemacht ( Rn. 3).
[32]
Wank , Auslegung, S. 23.
[33]
Rüthers/Fischer/Birk , Rechtstheorie, Rn. 129; Schwacke , Methodik, S. 28, 32 f, 38.
[34]
Schmalz , Methodenlehre, Rn. 113.
[35]
Zum Ganzen siehe Schmalz , Methodenlehre, Rn. 101; Schwacke , Methodik, S. 27. Im Zivilrecht führen negative Formulierungen „nicht selten“ zu einer Beweislastverschiebung(z.B. muss nach § 932 Abs. 2 BGB der Eigentümer beweisen, dass der „Erwerber […] nicht in gutem Glauben“ war – und nicht etwa der Erwerber seinen guten Glauben), siehe Vogel , Methodik, S. 69. Vgl. auch Rn. 99.
[36]
Zum Ganzen siehe Beaucamp/Beaucamp , Methoden, Rn. 52 ff.; Mann , Einführung, Rn. 233 f.; Schmalz , Methodenlehre, Rn. 35 f. Adomeit/Hähnchen , Rechtstheorie, Rn. 85 weisen darauf hin, dass es „in der deutschen (Rechts-)Sprache […] zwei verschiedene ,oder‘, das ‚oder/und‘[so z.B. in § 823 Abs. 1 BGB bzgl. der dort genannten Rechtsgüter] und das ‚entweder/oder‘“ (z.B. in § 123 Abs. 1 StGB bzgl. der dort vorgesehenen Strafen) gibt (Hervorhebungen z.T. im Original). Siehe auch Rn. 141.
[37]
Nach Beaucamp/Beaucamp , Methoden, Rn. 58; Muthorst , Grundlagen, § 5 Rn 32 f.; Schwacke , Methodik, S. 42 ff.; Wank , Auslegung, S. 11 f., 14; Zippelius , Methodenlehre, S. 25 ff.
[38]
Auch aufder Rechtsfolgenseitefinden mal mehr, mal weniger bestimmte Rechtsbegriffe Verwendung, siehe im Skript „Allgemeines Verwaltungsrecht“, Rn. 225. Entsprechendes gilt für deskriptive/normative Merkmale, siehe Schwacke , Methodik, S. 28. Zur Frage, ob es sich bei der Ausfüllung namentlich von Generalklauseln noch um Gesetzesauslegungoder schon um Rechtsfortbildunghandelt, siehe Rn. 233 a.E.
[39]
Hierzu sowie zum gesamten Folgenden siehe Beaucamp/Beaucamp , Methoden, Rn. 47 ff.; Schwacke , Methodik, S. 25 ff., 48 f. m.w.N. zur a.A., wonach zwischen un- und bestimmten sowie zwischen deskriptiven und normativen Begriffen nicht differenziert werden könne; Staake , Jura 2018, S. 661 (668); Vogel , Methodik, S. 13 f. Wank , Auslegung, S. 46 zufolge werde„ durch die Aufnahme in ein Gesetz […] jeder ,deskriptive Begriff‘ zwangsläufig zu einem normativen“.
[40]
Zur Kennzeichnung dieser Unterschiede differenzieren Rüthers/Fischer/Birk , Rechtstheorie, Rn. 182 f. zwischen „ verweisenden normativen Begriffen“ (im o.g. Beispiel: „Eigentum“) und „ offenen normativen Begriffen“ (im o.g. Beispiel: „Kunst“). Typusbegriffe( Rn. 84) werden von Schmalz , Methodenlehre, Rn. 155 als „Zwischenerscheinungen“ zwischen deskriptiven und normativen Begriffen behandelt.
Читать дальше