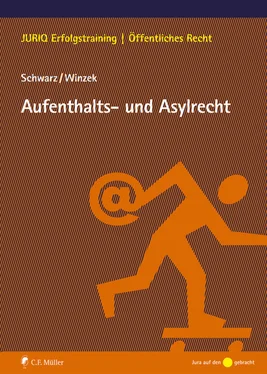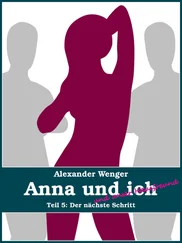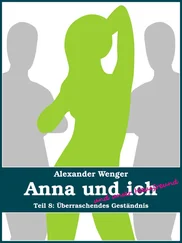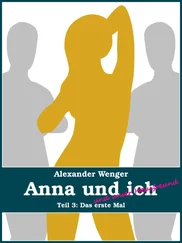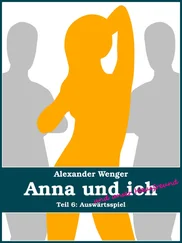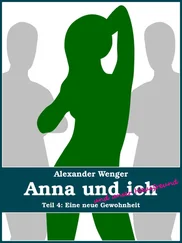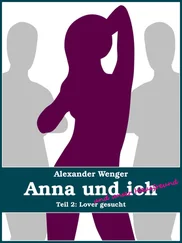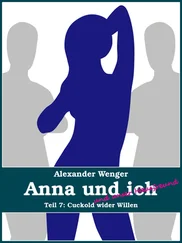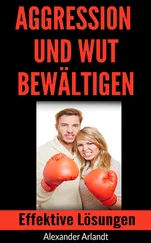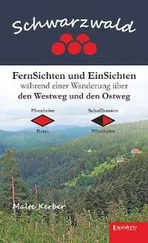[3]
Dreier Art. 16a Rn. 93; Heusch/Haderlein/Schönenbroicher Rn. 28 ff.
[4]
Dreier Art. 16a Rn. 47.
[5]
Mangoldt/Klein/Starck Art. 16a Rn. 146.
[6]
Jarass/Pieroth Grundgesetz, Art. 16a Rn. 7.
[7]
Vgl. zu alledem u.a. BVerfGE 9, 174 (180); 52, 391 (398); 80, 315 (335); BVerwGE 120, 16 (20).
[8]
BVerfGE 81, 141 (152).
[9]
BVerwGE 55, 82.
[10]
BVerfGE 76, 143 (157).
[11]
Vgl. BVerwGE 85, 139 (142); 87, 141 (146).
[12]
BVerfGE 80, 315 (338).
[13]
BVerfGE 80, 315 (336).
[14]
BVerwGE 80, 315 (352).
[15]
BVerfGE NVwZ 1994, 319 (392); BVerfGE 80, 315 (333).
[16]
BVerfGE NVwZ 1991, 768 (769).
[17]
BVerwG vom 7.10.1975 – I C 34.71; Mangoldt/Klein/Starck Art. 16a Rn. 58.
[18]
BVerfGE 94, 115 (133).
[19]
BVerfGE 94, 49 (95).
[20]
BVerfGE 94, 166.
[21]
BVerfGE 94, 49 (95).
[22]
Mangoldt/Klein/Starck Art. 16a Rn. 164.
[23]
BVerfGE 94, 49 (93).
[24]
Vgl. Hailbronner Rn. 497.
[25]
BVerfGE 94, 49 (92 f.).
[26]
Mangoldt/Klein/Starck Art. 16a Rn. 166 m.w.N.
[27]
Tiedemann S. 64; Göbel-Zimmermann/Eichhorn/Beichel-Benedetti Rn. 96.
[28]
BVerfGE 94, 115 (147).
[29]
Mangoldt/Klein/Starck Art. 16a Abs. 1 Rn. 91.
[30]
Vgl. BVerwGE 67, 314.
[31]
BVerwG NVwZ 1194, 1123.
[32]
Mangoldt/Klein/Starck Art. 16a Rn. 94.
[33]
Göbel-Zimmermann/Eichhorn/Beichel-Benedetti Rn. 79.
[34]
BVerfGE 74, 51.
[35]
BVerfGE 74, 51 (64).
[36]
BVerfGE 74, 51 (65).
[37]
BVerfGE 74, 51 (66).
[38]
Tiedemann S. 40 f.
[39]
Vgl. BVerwG NVwZ 1996, 86.
[40]
Jarass/Pieroth Grundgesetz, Art. 16a Rn. 7.
[41]
BVerfGE 9, 174 (180); 52, 391 (398); 80, 315 (335).
[42]
BVerfGE 76, 143 (157).
[43]
BVerwGE 80, 315 (352).
3. Teil Das materielle Asylrecht› C. Asylrecht für Flüchtlinge
C. Asylrecht für Flüchtlinge
3. Teil Das materielle Asylrecht› C. Asylrecht für Flüchtlinge› I. Der Flüchtlingsstatus
95
Nachdem wir das nationale Asylrecht aus Art. 16a GG näher untersucht haben, widmen wir uns nun den weiteren Formen des Asyls, die von einem Schutzsuchenden beantragt werden können. Allen voran soll hier auf den Flüchtlingsstatus eingegangen werden.
Hinweis
Um gleich zu Beginn Verwechslungen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, dass im Verhältnis zum Flüchtlingsstatus häufig auch der Begriff internationale Schutzberechtigung benutzt wird.[1] Dieser Begriff umfasst allerdings nicht nur den Flüchtlingsstatus, sondern auch den subsidiären Schutz, den wir im nächsten Kapitel besprechen werden.
Hinweis
Lediglich von semantischer, nicht aber von inhaltlicher Relevanz ist zudem die terminologische Unterscheidung von Anerkennung der Asylberechtigung nach Art. 16a Abs. 1 GG und der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach AsylG. Diese Differenzierung folgt aus der Überlegung, dass die politische Verfolgung zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits vorliegt und damit auch die Asylberechtigung. Die Entscheidung der zuständigen Behörde hat insofern lediglich deklaratorische Wirkung. Die Flüchtlingseigenschaft hingegen entsteht erst mit der positiven Entscheidung der Behörde, hat also konstitutive Wirkung.
3. Teil Das materielle Asylrecht› C. Asylrecht für Flüchtlinge› II. Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
II. Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
96
Lesen Sie die zitierte Norm!
Den Flüchtlingsstatus können dem Wortlaut nach nur Flüchtlinge beanspruchen. Wer Flüchtling ist, ist in § 3 Abs. 1 AsylG legal definiert:

Ein Ausländer ist Flüchtling, wenn er sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb seines Herkunftslandes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er aus Furcht nicht beanspruchen kann oder will.
Hinweis
Diese Definition ist mit der europarechtlichen Definition in Art. 2 lit. d. Qualifikations-RL identisch. Beide Definitionen sind aus der GFK übernommen und sind entsprechend auch nach dem Telos der GFK zu interpretieren.
97
Flüchtlingseigenschaft nach § 3 AsylG
I. Qualifizierte Verfolgung
1.Verfolgungshandlung
Definition Rn. 99
Ungeschriebene Voraussetzung eines Polit-Malus Rn. 103
2.Verfolgungsgründe
3.Zusammenhang von Verfolgungshandlung und -grund
4.Verfolgungsakteure
5.Schutzakteure
6.Verfolgungssubjekte
7.Schutzlosigkeit
II. Begründete Furcht
Furcht vor Verfolgung bei inländischer Fluchtalternative Rn. 115
III. Aufenthalt außerhalb des Herkunftslandes
Asylantrag in deutscher Botschaft Rn. 119
IV. Kein Ausschluss der Zuerkennung
Auslegung des Begriffs einer schweren nichtpolitischen Straftat Rn. 123
V. Keine Versagung der Zuerkennung
Hinweis
Teilweise wird mit Bezug auf die genannten Tatbestandsmerkmale von Inklusionsklauseln als Abgrenzung zu Ausschlussgründen, die Exklusionsklauseln genannt werden, gesprochen.[2] Letztere werden wir noch gesondert behandeln.
1. Qualifizierte Verfolgung
98
Die eben erörterte begründete Furcht muss sich nach dem Wortlaut des § 3 Abs. 1 AsylG auf eine Verfolgung beziehen. Der Wortlaut des § 3 Abs. 1 AsylG konkretisiert hierbei, welche Anforderungen an die Verfolgung zu stellen sind. Es muss demnach eine qualifizierte Verfolgung vorliegen. Die einzelnen Kriterien werden in der Folge genauer dargestellt.
Hinweis
Die §§ 3 ff. AsylG normieren recht detailliert die einzelnen Anforderungen, die in den folgenden Abschnitten besprochen werden. Nutzen Sie das Gesetz und lesen Sie die zitierten Normen. Sie werden feststellen, dass sich alle relevanten Informationen direkt aus dem AsylG ergeben.
99
Wann eine Verfolgung vorliegt, hängt in erster Linie von der Handlung ab, die dem Betroffenen widerfährt. In § 3a Abs. 1 AsylG sind Verfolgungshandlungen legal definiert (lesen!). Diese Definition entspricht der Regelung der Qualifikations-RL. In § 3a Abs. 2 AsylG sind darüber hinaus Beispiele für Handlungen nach Abs. 1 aufgelistet. Auf diese Struktur soll nun vertiefend eingegangen werden.
aa) Verfolgungshandlungen nach § 3a Abs. 1 Nr. 1 AsylG
100
Lesen Sie den § 3a AsylG und Art. 15 Abs. 2 EMRK!

Nach § 3a Abs. 1 Nr. 1 AsylG sind Verfolgungshandlungen solche, die „auf Grund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sind, dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellen, insbesondere der Rechte, von denen nach Art. 15 Abs. 2 EMRK keine Abweichung zulässig ist“. Schwierigkeiten bereitet hierbei zunächst die Definition des Merkmals grundlegender Menschenrechte. Die Norm verweist zur näheren Konkretisierung auf die in Art. 15 Abs. 2 EMRK genannten Rechte. Hierbei handelt es sich um sog. notstandsfeste bzw. grundlegende Rechte. Die Annahme, es handele sich bei diesen Rechten um grundlegende Menschenrechte, liegt damit nicht fern. Allerdings ist zu beachten, dass der Wortlaut des § 3a Abs. 1 Nr. 1 AsylG im Zusammenhang mit seiner Verweisung auf den Art. 15 Abs. 2 EMRK von „insbesondere“ spricht. Die grundlegenden Menschenrechte müssen sich also inhaltlich von denen des Art. 15 Abs. 2 EMRK abgrenzen. Solche grundlegenden Menschenrechte mit wesensgleichen Gewährleistungen stellen nach herrschender Meinung die in Art. 4 Abs. 2, 11, 16 und 18 IPbürgR verbürgten Rechte dar.[3]
Читать дальше