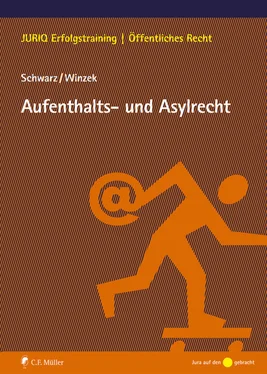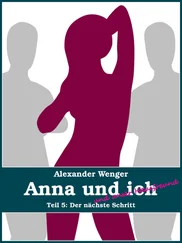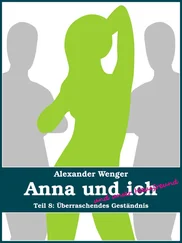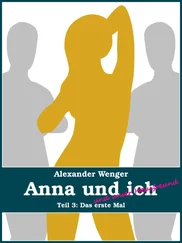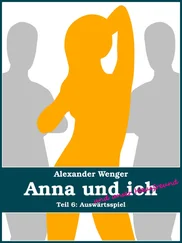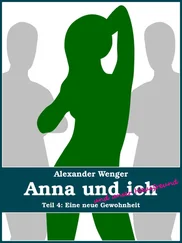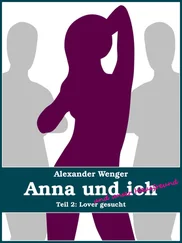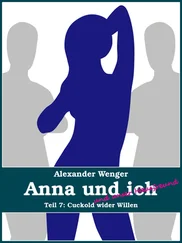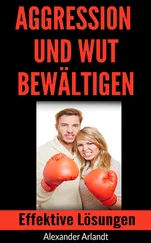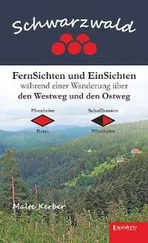1 ...8 9 10 12 13 14 ...22 47

Die Einordnung des Asylgrundrechts als Leistungs- oder Abwehrrecht wird in Literatur und Rechtsprechung nicht einheitlich beurteilt. Nach einer Ansicht handelt es bei Art. 16a Abs. 1 GG um ein Leistungsrecht.[1] Die Erteilung der Asylberechtigung auf Grund der Norm stelle demnach eine Leistung des Staates dar, die auf Antrag erteilt wird. Dieser Ansicht ist aber entgegen zu halten, dass die Eigenschaft der Asylberechtigung quasi erst durch die Entscheidung der Behörde im Einzelfall entstünde. Diese prüft aber lediglich das Vorliegen der Voraussetzungen, sodass ihre Entscheidung nur deklaratorischen Charakter hat und mithin eine Feststellung eines vorhandenen Zustandes ist. Unter anderem aus diesem Grund geht die wohl überwiegende Meinung in Literatur und Rechtsprechung davon aus, dass es sich bei Art. 16a Abs. 1 GG um ein Abwehrrecht handele.[2] Der Betroffene, dem grundsätzlich ein Asylrecht zusteht, soll sich gegen staatliche Eingriffe (z.B. die Weigerung der Anerkennung der Asylberechtigung) wehren können.
Für die Einordnung als Leistungsrecht spricht aus verfahrensrechtlicher Sicht, dass die Ausstellung eines Aufenthaltstitels eine Leistung des Staates darstellt. Unter den Voraussetzungen des Art. 16a GG und den mit ihm verbundenen einfachen Gesetzen hätte der Ausländer demnach einen Anspruch auf Ausstellung des Aufenthaltstitels. Dagegen kann man jedoch den Wortlaut des Art. 16a Abs. 1 GG anführen, der davon spricht, dass politisch Verfolgte Asylrecht „genießen“. Ob der Ausländer asylberechtigt ist, ist zwar zunächst zu prüfen, aber dazu muss ihm die Möglichkeit der Berufung auf Art. 16a Abs. 1 GG zunächst einmal eingeräumt werden. Daraus würde zwar ebenfalls folgen, dass das Asyl erst auf Grund einer Leistung des Staates gewährt wird. Allerdings erfolgt die Erteilung der Asylberechtigung letztlich auf Grund von Merkmalen, die bereits bei Antragstellung vorliegen. Man könnte daher von einer nur deklaratorischen Entscheidung ausgehen oder aber hierin eine Vorwirkung der Entscheidung sehen. Letztlich ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass der Staat mit negativen Asylentscheidungen in das Recht auf Asylgewährung des Betroffenen eingreift (subjektiv-öffentlicher Charakter der Norm). Entsprechend muss der Betroffene die Möglichkeit erhalten, diese Eingriffe abzuwehren. Hier stellt sich, dem Wortlaut des Art. 16a Abs. 1 GG nach, die Norm schützend vor den Betroffenen. Aus diesen Erwägungen folgert die wohl herrschende Meinung, dass es sich bei Art. 16a Abs. 1 GG um ein Abwehrrecht handeln muss.
3. Schranken des Asylgrundrechts
48
Das Asylrecht des Art. 16a Abs. 1 GG scheint auf den ersten Blick nicht schrankenlos gewährt zu sein. Seit der Übertragung des Art. 16 Abs. 2 S. 2 a.F. GG in Art. 16a Abs. 2 GG und der Erweiterung um die Absätze 2 bis 4 wird das Asylrecht nur noch unter besonderen Einschränkungen gewährt. Hierbei gilt es insbesondere folgende zu differenzieren:
| • |
Die sog. Drittstaatenklausel in Abs. 2 GG beschränkt in Satz 1 den persönlichen Schutzbereich des Art. 16a Abs. 1 GG zuungunsten der Unionsbürger und stellt somit lediglich eine verfassungsunmittelbare Schranke dar, |
| • |
die sog. Herkunftsstaatenklausel in Abs. 3 ermöglicht eine Regelung, nach der Personen aus bestimmten Herkunftsstaaten von der Asylgewährung nach Art. 16a Abs. 1 GG ausgenommen sind. |
Auf die einzelnen Beschränkungen und Ausnahmen soll an späterer Stelle noch vertieft eingegangen werden. Hier soll lediglich eine kurze Übersicht erfolgen.
49
Die Drittstaatenklausel in Abs. 2 S. 1 erklärt zunächst alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union für als grundsätzlich sicher. Darüber hinaus ermöglicht Abs. 2 S. 2 die Schaffung einer Liste ebenfalls sicherer Drittstaaten. Ähnlich verhält es sich mit der Herkunftsstaatklausel in Abs. 3 S. 1. Auf Grund dieser kann der Bundesgesetzgeber Drittstaaten zu sicheren Herkunftsländern erklären. Diese Regelungen stellen jedoch keinen Einschränkungsvorbehalt dar, sondern dienen lediglich der Begrenzung des Schutzbereichs bzw. des Verfahrens und sind demnach nicht mehr als verfassungsunmittelbare Beschränkungen.[3]
JURIQ-Klausurtipp
Demnach unterliegt das Asylrecht aus Art. 16a Abs. 1 GG, wie zuvor auch jenes aus Art. 16 Abs. 2 S. 2 a.F. GG, keinen der Norm immanenten Gesetzesvorbehalten. Allerdings ist das Asylrecht damit nicht vorbehaltlos gewährt. Vielmehr ist möglicherweise kollidierendes Verfassungsrecht zu beachten und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit eine entsprechende Abwägung der widerstreitenden Interessen vorzunehmen.
50
Sollten Sie mit den Begrifflichkeiten nicht mehr vertraut sein, so empfiehlt es sich, die Dogmatik im Skript „Grundrechte“ zu wiederholen.
Das Asylgrundrecht ist damit aber nicht schrankenlos gewährt. Es sind auch bei Art. 16a Abs. 1 GG verfassungsimmanente Schranken zu beachten. Auf Grund der Entstehungsgeschichte der Norm, als Reaktion auf die Verletzung menschenrechtlicher Standards, soll Art. 16a Abs. 1 GG es den Betroffenen ermöglichen, sich einer entsprechenden Behandlung durch Flucht zu entziehen. Demnach vermittelt Art. 16a Abs. 1 GG eine Mindestgarantie in Bezug auf die Menschenwürde.[4] Dies ist im Rahmen einer Abwägungsentscheidung besonders zu berücksichtigen, sodass gerade bei der Prüfung des Art. 16a Abs. 1 GG die Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1 GG eine wichtige Schranke spielt.
51

Stuft man Art. 16a Abs. 1 GG als ein Leistungsrecht ein (vgl. Rn. 47), so ergibt sich bei der Suche nach Beschränkungen auch die Frage, ob die Inanspruchnahme des Asyls unter einem Kapazitätsvorbehalt steht. Dieser Vorbehalt entspringt letztlich der Überlegung, dass Ansprüche generell unter dem Vorbehalt des Möglichen stünden.[5] Problematisch ist insofern jedoch, ob dieser Gedanke auf das Asylgrundrecht übertragbar ist. Es geht letztlich insbesondere um menschenrechtliche Aspekte, die hier einer strikten Grenze entgegenstehen. Allerdings kann auch keine Hilfe über ein solches Maß hinaus gewährleistet werden, bei dem es zu einer grundsätzlichen Notsituation in der deutschen Bevölkerung kommt.
JURIQ-Klausurtipp
Es handelt sich um ein Problem, welches bei entsprechenden Hinweisen im Sachverhalt im Rahmen der Abwägungsentscheidung in der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs zu berücksichtigen ist. Dabei steht der Kapazitätsvorbehalt in einem engen Spannungsverhältnis mit den im Einzelfall relevanten Aspekten der Menschenwürde.
52
Das nationale Asylrecht wird trotz des großen Einflusses durch das europäische Asylrechtsregime (GEAS) und dessen nationale Ausformungen nicht gänzlich überlagert und verliert in Folge dessen auch nicht seine praktische Relevanz. So erscheint der Art. 16a Abs. 1 GG in der heutigen Asylrechtspolitik nur eine untergeordnete Rolle zu spielen, ist aber doch Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Gewährung von Asyl in Deutschland geht. Nicht zuletzt kommt dieser Norm auch die verfassungsprozessrechtliche Funktion zu, den Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung des Asylrechts zu ermöglichen.
53
Dennoch ist festzustellen, dass in der Praxis die einfachgesetzlichen nationalen Regelungen sowie das GEAS zusammen mit einigen völkerrechtlichen Bestimmungen, wie der GFK, das Asylrechtsregime auf nationaler Ebene dominieren. Dies nicht zuletzt, da insbesondere auf Grund der GEAS die Anerkennung eines Verfolgten als Flüchtling in § 3 AsylG und die Gewährung subsidiären Schutzes in § 4 AsylG aufgenommen wurden. Darüber hinaus ist der Verfolgungsbegriff, den Art. 16a Abs. 1 GG voraussetzt, dem Flüchtlingsbegriff in Art. 1 A Nr. 2 GFK inhaltlich sehr ähnlich. Zudem erfolgt wegen § 2 Abs. 1 und 3 AsylG auf Rechtsfolgenseite eine faktische Gleichstellung von Asylberechtigten nach Art. 16a Abs. 1 GG und Flüchtlingen i.S.d. der GFK. Darauf wird später noch näher einzugehen sein.
Читать дальше