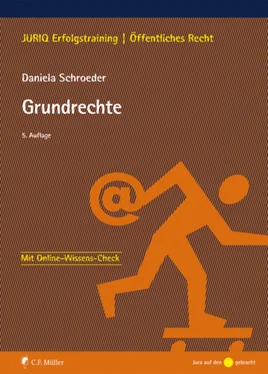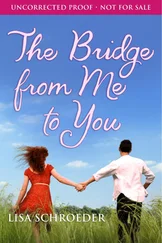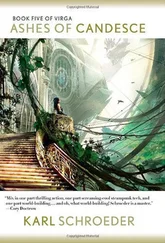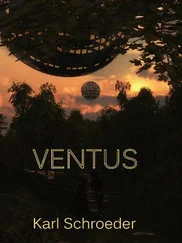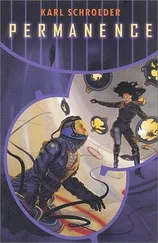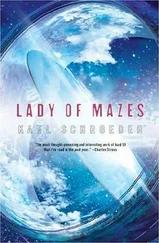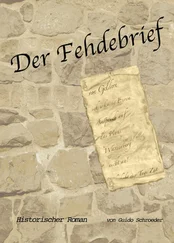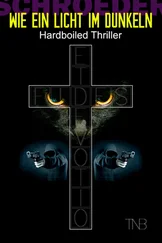69
Bevor Sie in der Fallbearbeitung Ihre eigentliche Prüfung beginnen, müssen Sie vorab klären, welche Freiheitsrechte überhaupt thematisch einschlägigsein könnten. Hierfür ist es notwendig, den Sachverhalt in groben Zügen gedanklich unter die einzelnen Grundrechte zu subsumieren. Behandelt Ihr Fall z.B. eine Versammlung, kommen als möglicherweise einschlägige Freiheitsrechte insbesondere die Grundrechte aus Art. 8 Abs. 1 GG, Art. 5 Abs. 1 S. 1 Var. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 GG in Betracht. Kommen Sie nach dieser Vorabprüfung zu dem Ergebnis, dass mehrere Grundrechte thematisch einschlägig sein könnten, beginnen Sie Ihre Prüfung grundsätzlich mit dem sachnächsten Freiheitsrecht, im o.g. Beispiel also mit Art. 8 Abs. 1 GG (vgl. zu einer Ausnahme unten Rn. 117). Jedes Freiheitsrecht prüfen Sie danach getrennt nacheinander. In diesem Rahmen werden auch die Grundrechtskonkurrenzen besprochen.
70
Jede Grundrechtsprüfung beginnt mit einem Obersatz, der allgemein wie folgt formuliert werden könnte: „Der Hoheitsakt des/der . . . (hier den Hoheitsträger nennen) könnte . . . (hier den/die möglicherweise verletzten Grundrechtsträger nennen) in seinem/ihrem Grundrecht auf . . . aus Art. . . . GG (hier möglicherweise verletztes Freiheitsrecht nennen) verletzen.“
JURIQ-Klausurtipp
Formulieren Sie den Obersatz möglichst präzise. Dies erleichtert nicht nur Ihnen den Einstieg in die Prüfung, sondern dient auch dem Korrektor als Orientierung.
2. Teil Grundlagen› B. Grundrechte als Freiheitsrechte in der Fallbearbeitung› II. Eröffnung des Schutzbereichs des Freiheitsrechts
II. Eröffnung des Schutzbereichs des Freiheitsrechts
71
Ihre eigentliche Prüfung beginnen Sie mit der Untersuchung, ob der Schutzbereich des möglicherweise verletzten Freiheitsrechts eröffnet ist. Innerhalb des Schutzbereichs wird herkömmlich zwischen dem sachlichen und dem persönlichen Schutzbereich unterschieden; außerdem können Grundrechtskonkurrenzen relevant werden. Ob der Schutzbereich eines Freiheitsrechts tatsächlich eröffnet ist, prüfen Sie durch Auslegung der thematisch einschlägigen Grundrechte zunächst anhand ihres Wortlauts, danach anhand ihrer systematischen Stellung sowie ihres Sinns und Zwecks; ergänzend können die historische Auslegung und die genetische Auslegung herangezogen werden.
1. Sachlicher Schutzbereich
72
Zunächst prüfen Sie, ob der sachliche Schutzbereich des Freiheitsrechts eröffnet ist. Freiheitsrechte schützen Tätigkeiten, Verhaltensweisen, Rechtsgüter etc.Indem Sie ein Freiheitsrecht auslegen, werden Sie erkennen, ob der sachliche Schutzbereich des Grundrechts eröffnet ist. Bei diesem Prüfungspunkt ist es unverzichtbar, die wichtigsten Definitionen der Begriffe, die zum sachlichen Schutzbereich der Freiheitsrechte gehören, zu kennen.
Beispiel
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG schützt u.a. die freie Meinungsäußerung. Ob der sachliche Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 S. 1 Var. 1 GG in einem konkreten Fall eröffnet ist, hängt entscheidend davon ab, ob eine „Meinung“ geäußert wurde.
73
Manche Freiheitsrechte enthalten sachliche Begrenzungendes Schutzbereichs, die Sie ebenfalls beachten müssen, weil das Grundrecht in diesem Falle zwar thematisch einschlägig, aber wegen der sachlichen Begrenzung nicht in seinem Schutzbereich eröffnet sein kann.
Beispiel
Art. 8 Abs. 1 GG gewährleistet die Versammlungsfreiheit. Vom sachlichen Schutzbereich erfasst sind jedoch nur solche Versammlungen, die „friedlich und ohne Waffen“ durchgeführt werden. Unfriedliche und bewaffnete Versammlungen fallen daher nicht in den sachlichen Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 GG. Grundrechtlicher Schutz kann in diesem Falle nur über das Auffanggrundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG begehrt werden.
Hinweis
Im Zweifel legen Sie den sachlichen Schutzbereich weit aus. Auch das Bundesverfassungsgericht legt den Schutzbereich im Zweifel extensiv aus, um einen möglichst weit reichenden Grundrechtsschutz zu gewährleisten. Es gilt also: „In dubio pro libertate“(„im Zweifel zugunsten der Freiheit“).
2. Persönlicher Schutzbereich
74
Die Eröffnung des persönlichen Schutzbereichs prüfen Sie in drei Schritten:
JURIQ-Klausurtipp
Denken Sie noch einmal daran: Das Prüfungsschema dient Ihnen nur als Orientierung. Auf einzelne Prüfungsschritte brauchen Sie nur dann näher einzugehen, wenn sie in Ihrer Fallbearbeitung problematisch und daher erörterungsbedürftig sind! Keinesfalls dürfen Sie das Schema in Ihrer Falllösung stur abarbeiten.
a) Grundrechtsfähigkeit
aa) Begriff
75
Im ersten Schritt prüfen Sie die Grundrechtsfähigkeit der Person(en), die in dem zu prüfenden Freiheitsrecht möglicherweise verletzt ist/sind.
76

Grundrechtsfähigist jeder, der generell Träger von Grundrechten sein kann.
Für die Frage, ob eine Person grundrechtsfähig ist, ist damit eine abstrakte, d.h. vom konkreten Einzelfall unabhängigeBetrachtung maßgeblich.
77
Wiederholen Sie ggf. an dieser Stelle die zivilrechtliche Rechtsfähigkeit!
Materiell-rechtlich betrachtet, entspricht die Grundrechtsfähigkeit der Rechtsfähigkeit im Zivilrecht.
Beispiel
Ein Nichtdeutscher im Sinne des Art. 116 GG ist grundrechtsfähig, weil er generell Träger von Grundrechten (z.B. Art. 4, Art. 2 Abs. 2 S. 1, Art. 2 Abs. 1 GG) sein kann. Dass er hinsichtlich der Deutschengrundrechte (z.B. Art. 8 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG) nicht berechtigt ist, ist (erst) eine Frage seiner Grundrechtsberechtigung (s.u. Rn. 99 ff.).
bb) Grundrechtsfähige Personen
78
Generell können sowohl natürliche als auch juristische Personen grundrechtsfähig sein.
79
Grundrechtsfähig sind zunächst natürliche Personen, d.h. Menschen.[2]
(a) Dauer der Grundrechtsfähigkeit
80
Die Grundrechtsfähigkeit natürlicher Personen beginnt grundsätzlich mit der Vollendung der Geburtund dauert bis zum Tod. Abweichend hiervon hat das Bundesverfassungsgericht die Grundrechte aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG und Art. 1 Abs. 1 GG auch beim Nasciturus(werdendes Leben) angewendet.[3] Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht ein postmortales Persönlichkeitsrechtanerkannt.[4] Hiernach endet die staatliche Verpflichtung, den Einzelnen gegen Angriffe auf seine Menschenwürde zu schützen, erst nach Ablauf eines angemessenen Zeitraums nach dem Tod.
81

Nach den bisherigen Ausführungen wissen wir, dass einzelne natürliche Personen grundrechtsfähig sind. Nun stellt sich aber die Frage, wie der Fall zu beurteilen ist, wenn sich mehrere natürliche Personen zusammenschließen. Grundrechtsfähig sind in diesem Falle – nach den bisherigen Erörterungen – unproblematisch die einzelnen natürlichen Personen als Mitglieder der Personenmehrheit. Grundrechtsfähig könnte aber auch die Personenmehrheit selbst sein.
Beispiel
D, E und F bilden hobbymäßig eine Musikband. Meist musizieren sie stundenlang am Wochenende in der Wohnung des D. Der Vermieter des D wohnt unmittelbar unter D und ist über die musikalischen Aktivitäten seines Mieters wenig erfreut. Daher will er das Musizieren am Wochenende zukünftig weitestgehend unterbinden.
Читать дальше