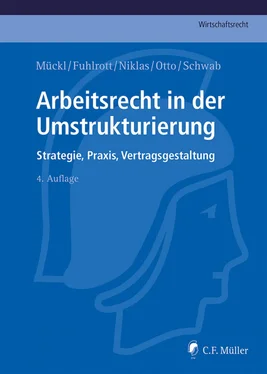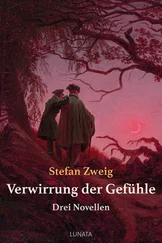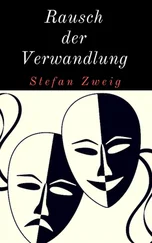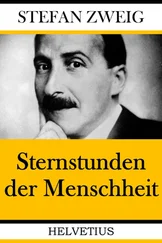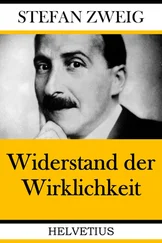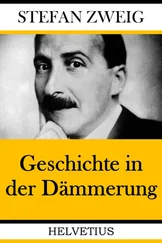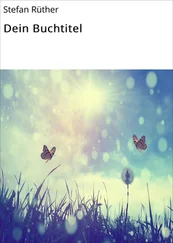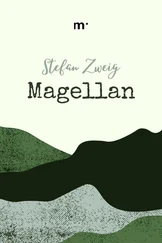31
Gestaltungsziele mit Blick auf tarifliche Arbeitsbedingungen können – außerhalb einer Insolvenz[43] – ebenfalls häufig besonders effizient durch gesellschaftsrechtliche Maßnahmen erreicht werden, da die Tarifbindung an den jeweiligen Rechtsträger, d.h. dessen Eigenschaft als Vertragspartei bzw. Mitglied des tarifschließenden Arbeitgeberverbands, anknüpft.
| – |
Dies gilt insbesondere mit Blick auf eine effiziente Beendigung der Bindung an Verbandstarifverträge, da die Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband, welche die Tarifbindung vermittelt, im Rahmen einer umwandlungsrechtlichen (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge nicht übertragen wird.[44] |
| – |
Für Firmentarifverträge bestehen ebenfalls interessante umwandlungsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten, da im Rahmen einer Spaltung nach der zutreffenden Rechtsprechung des BAG eine Zuweisung des Firmentarifvertrags zu einem der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger erfolgen muss.[45] Eine Vervielfältigung der Parteistellung an einem Firmentarifvertrag findet infolge einer umwandlungsrechtlichen Spaltung nicht statt. Bei dem Rechtsträger, dem die Parteistellung bzgl. des Firmentarifvertrags nicht zugewiesen worden ist, gilt dieser vielmehr analog § 4 Abs. 5 TVG weiter, was dem betroffenen Rechtsträger die Möglichkeit eröffnet, durch andere Abmachungen i.S.d. § 4 Abs. 5 TVG eine Veränderung der tariflichen Arbeitsbedingungen zu erreichen.[46] |
32
Praxistipp:
Bestehen in den Arbeitsverträgen der betroffenen Arbeitnehmer dynamische Bezugnahmeklauseln, welche die bei dem übernehmenden Rechtsträger nunmehr anwendbaren anderen Tarifverträge auch arbeitsvertraglich zur Anwendung bringen, müssen mit den betroffenen Mitarbeitern nicht einmal neue arbeitsvertragliche Absprachen getroffen werden.[47]
| – |
Zudem können auch im Rahmen einer übertragenden Umwandlung ggf. die Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden, die sich aus dem neuen § 4a TVG ergeben.[48] |
4. Share Deal bzw. Abschluss von Unternehmensverträgen als Mittel zur Veränderung der konzernbezogenen Mitbestimmung
33
Unmittelbar arbeitsrechtlich relevant kann ein Gesellschafterwechsel, der dennoch lediglich die oben unter Rn. 7 ff.beschriebenen Unterrichtungs- und Beratungsrechte auslöst, vor allen Dingen mit Blick auf die Konzernstrukturen für die Unternehmensmitbestimmung und/oder die betriebliche Mitbestimmung auf Konzernebene werden, wenn hierdurch erstmals ein Unterordnungskonzern i.S.d. § 18 AktG begründet oder ein solcher Konzern beseitigt wird. Dennoch ist die Konzernbildung ein rein gesellschaftsrechtlicher Vorgang, welcher dem Einfluss der betrieblichen Arbeitnehmervertretungen (Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat) entzogen ist, sofern er nicht mit tatsächlich-organisatorischen Änderungen i.S.d. § 111 BetrVG verbunden wird.[49]
34
Praxistipp:
Dies gilt auch für den Abschluss von Gewinnabführungsverträgen,[50] die für sich genommen gegenüber einem Beherrschungsvertrag vorteilhaft sein können, wenn im Rahmen einer dem DrittelbG unterliegenden Konzernstruktur eine Zurechnung nach § 2 Abs. 2 DrittelbG vermieden werden soll (dazu gleich unter Rn. 40).
35
Die Arbeitnehmerseite kann sowohl bei dem Abschluss eines Beherrschungsvertrags (§§ 291 ff. AktG) als auch bei der Bildung eines faktischen Konzerns (§§ 311 ff. AktG) allein auf der Ebene der Unternehmensmitbestimmung (durch Arbeitnehmervertreter in einem mitbestimmten Aufsichtsrat) Einfluss nehmen, z.B. durch entsprechendes Abstimmungsverhalten im Hinblick auf den Abschluss eine Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags.[51]
36
Auf betrieblicher Ebene besteht nur – aber immerhin – ein Auskunfts- und Beratungsanspruch des Wirtschaftsausschusses nach § 106 Abs. 3 Nr. 10 BetrVG. Das BetrVG enthält insbesondere keine Vorgaben zur Arbeitnehmerbeteiligung als Wirksamkeitsvoraussetzung für die Etablierung von Konzernstrukturen, sondern knüpft an die Etablierung bzw. Beseitigung entsprechender Strukturen lediglich Folgewirkungen.[52] Hiervon ausgehend kann ein Beteiligungserwerb bzw. eine Anteilsveräußerung zur Begründung oder Beendigung von Konzernverhältnissen führen, die mitbestimmungsrechtlich unter mehreren Gesichtspunkten relevant ist:
a) Erstmalige Bildung von Arbeitnehmervertretungen auf Konzernebene
37
Die Begründung eines Unterordnungskonzerns i.S.d. § 18 AktG kann erstmalig zur Gründung eines Konzernbetriebsrats[53] sowie dazu führen, dass im Rahmen der Unternehmensmitbestimmung Schwellenwerte für die Bildung eines mitbestimmten Aufsichtsrats nach § 2 DrittelbG bzw. § 5 MitbestG überschritten werden.
b) Erlöschen von Arbeitnehmervertretungen auf Konzernebene
38
Umgekehrt kann die Beendigung eines Unterordnungskonzerns i.S.d. § 18 AktG entweder dazu führen, dass der Konzernbetriebsrat als solcher erlischt[54] bzw. – bei Ausscheiden eines Rechtsträgers aus dem Unterordnungskonzern – bestimmte Mitglieder aus ihm ausscheiden.[55]
39
Ebenso kann die Beendigung eines Unterordnungskonzerns i.S.d. § 18 AktG dazu führen, dass – mangels Zurechnung nach § 5 MitbestG, § 2 Abs. 2 DrittelbG – die Schwellenwerte für eine Arbeitnehmermitbestimmung im Aufsichtsrat nach §§ 1 MitbestG, DrittelbG nicht mehr erreicht werden, sodass ein Statusverfahren (§ 97 AktG) zur Neubildung eines Aufsichtsrats ohne Arbeitnehmerbeteiligung durchzuführen ist.
40
Praxistipp:
Im Rahmen von § 2 Abs. 2 DrittelbG genügt es sogar, ohne Beseitigung der Konzernstruktur als solcher, den die Zurechnung nach dieser Norm bewirkenden Beherrschungsvertrag zu beenden, um eine Konzernzurechnung zu beenden und dadurch einen neuen, nicht mitbestimmten Status zu erreichen. Denn ein faktischer Konzern ist insoweit – anders als im Rahmen des § 5 MitbestG – für die Zurechnung nicht ausreichend.[56] In jedem Fall führt im Übrigen eine Neuordnung hin zu einem Gleichordnungskonzern zum Entfallen einer Zurechnung i.S.d. § 5 MitbestG, § 2 DrittelbG bzw. eines Konzernbetriebsrats (soweit dies nicht durch Vereinbarungen nach § 3 BetrVG[57] kompensiert werden kann und wird).
c) Geltung von Konzernbetriebsvereinbarungen
41
Ebenfalls relevant ist die Begründung bzw. Beendigung von Unterordnungskonzernverhältnissen für die Geltung von Konzernbetriebsvereinbarungen, die bei Einbezug in ein derartiges Konzernverhältnis erstmalig zur Anwendung kommen können.[58] Dies ist letztlich eine durch Auslegung zu klärende Frage ihres Geltungsbereichs.
42
Umgekehrt kann ein Ausscheiden aus dem Unterordnungskonzern zur Beendigung der Geltung von Konzernbetriebsvereinbarungen (wiederum eine Auslegungsfrage) bzw. zu deren Umwandlung in Gesamt- bzw. Einzelbetriebsvereinbarungen führen.[59]
43
Praxistipp:
In diesem Kontext sind auch Insolvenztatbestände relevant, weil die Insolvenz eines Unternehmens nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH bewirkt, dass es aus dem entsprechenden Konzernverbund ausscheidet.[60] Dies soll sogar dann gelten, wenn das herrschende Unternehmen von einer Insolvenz betroffen ist. Die geplante Änderung des Konzerninsolvenzrechts wird hieran nichts ändern.[61] Auch eine erhebliche Erweiterung von Mitbestimmungsrechten bei konzernweiten Insolvenzen wird mit ihr nicht verbunden sein.[62]
d) Einführung und Beendigung von Holdingstrukturen
aa) Einführung Holdingstrukturen
44
Während der Erwerb neuer Beteiligungen daher weitestgehend einer Einflussnahme durch Mitbestimmungsgremien entzogen ist, kann die Einführung einer Holdingstruktur zunächst dann in größerem Umfang Mitbestimmungsrechte auslösen, wenn sie durch übertragende Umwandlungen i.S.d. UmwG bewirkt wird. Es gelten dann die oben unter Rn. 23skizzierten und in Kapitel 4 Rn. 133 ff. ausführlich dargestellten Beteiligungsrechte.
Читать дальше