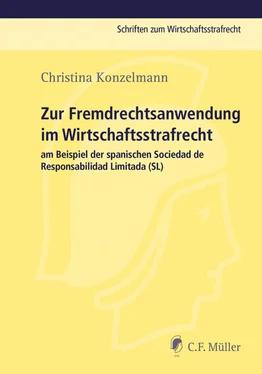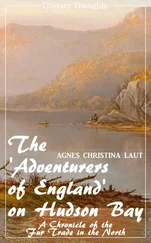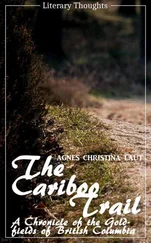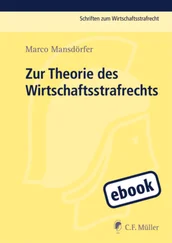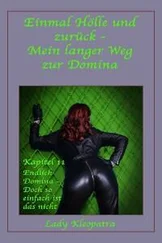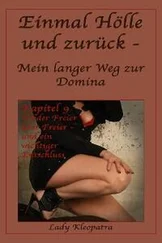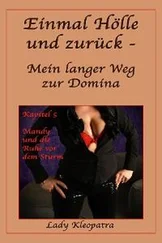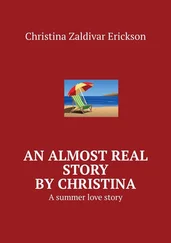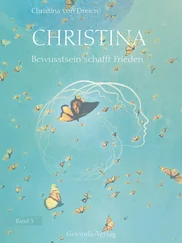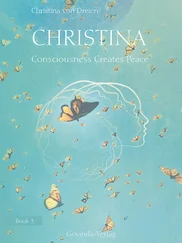d) OLG Karlsruhe, Urteil vom 21.2.1985 – 4 Ss 1/85
e) Kritische Würdigung der Rechtsprechung des BGH und des OLG Karlsruhe
7. Zwischenergebnis
Teil 4 Die Einflussnahme der Niederlassungsfreiheit auf das Gesellschaftskollisionsrecht
I.Niederlassungsfreiheit und Gesellschaftskollisionsrecht
1. Die Niederlassungsfreiheit nach Artt. 49, 54 AEUV
2. Zum Gesellschaftskollisionsrecht
a) Die Sitztheorie
b) Die Gründungstheorie
3. Konflikte der Niederlassungsfreiheit mit dem Internationalen Gesellschaftsrecht
II.Die Entscheidungen des EuGH zur Niederlassungsfreiheit
1. Centros
2. Überseering
3. Inspire Art
4. Folgen für das nationale Gesellschaftskollisionsrecht
III.Kollisionsrechtliche Ausgestaltung der Niederlassungsfreiheit durch den EuGH?
1. Niederlassungsfreiheit als gesellschaftskollisionsrechtliches Herkunftslandprinzip?
2. Kritik an einem kollisionsrechtlichen Herkunftslandprinzip
3. Zwischenergebnis
IV. Begrenzung des Beschränkungsbegriffs der Niederlassungsfreiheit
1. Zur Übertragbarkeit der Keck-Rechtsprechung auf die Niederlassungsfreiheit
2. Eingrenzung der Niederlassungsfreiheit auf marktzugangsbeschränkende Regelungen
a) Marktzugangsbehindernde Regelungen
b) Standortbedingungen
3. Zur Rechtfertigung niederlassungsbeschränkender mitgliedstaatlicher Regelungen
a) Geschriebene Rechtfertigungsgründe nach Art. 52 AEUV
b) Ungeschriebene Rechtfertigungsgründe
4. Folge einer ungerechtfertigten Beschränkung der Niederlassungsfreiheit
5. Zwischenergebnis
Teil 5 Die Einflussnahme der Niederlassungsfreiheit auf das Strafrecht
I. Zur „Europäisierung“ des Strafrechts
II. Zur „Neutralisierung“ von kollidierenden Strafvorschriften
III. Folgen aus der Niederlassungsfreiheit für das nationale Strafrecht
1. Gesellschaftsneutrale Straftatbestände
2. Gesellschaftsbezogene Straftatbestände
3. Quasi-gesellschaftsbezogene Straftatbestände
IV. Zwischenergebnis
Teil 6 Zur Fremdrechtsanwendung bei der spanischen SL
I. Zur Sitzverlegung einer SL ins EU-Ausland
II. Anwendbarkeit deutschen Strafrechts
III.Tätereigenschaft gemäß § 14 StGB
1. Zur Organ- und Vertreterhaftung
2. Die Interessentheorie des BGH
3. Zur Organhaftung des Verwalters der SL
4. Niederlassungsbeschränkende Wirkung der Organhaftung?
IV.Die Insolvenzstraftaten der §§ 283 ff. StGB
1. Die Insolvenzstraftaten im engeren Sinne
a) Zur Systematik der Insolvenzdelikte
b) Zur akzessorischen Ausgestaltung der Buchführungsdelikte
2. Kollisionsrechtliche Qualifizierung der Buchführungsdelikte
a) Öffentlich-rechtliche Qualifikation
b) Gesellschaftsrechtliche Qualifikation
c) Lösung über § 325a HGB?
d) Europarechtskonforme Auslegung der öffentlich-rechtlichen Qualifikation?
3. Zwischenergebnis
Teil 7 Verfassungsrechtliche Aspekte der Fremdrechtsanwendung
I. Bestimmtheit des Strafgesetzes als Gesetzlichkeitsprinzip
1. Abgrenzung der Blankettstrafgesetze von den normativen Tatbestandsmerkmalen
2. Abgrenzungskriterien der Literatur
a) Echte und unechte Blankettgesetze
b) Abgrenzung nach Art der tatbestandlichen Ergänzung
c) Differenzierung nach der Sinnhaftigkeit
d) Lösungsansatz von Wietz
3.Abgrenzungskriterien der Rechtsprechung
a) Abgrenzung nach dem Standort des zugehörigen Tatbestandes
b) Abgrenzung nach Art der (Un-)vollständigkeit
4. Zusammenfassung
5. Die Buchführungsdelikte als Blanketttatbestände
II.Zur Fremdrechtsanwendung bei Blankettstrafgesetzen
1. Verfassungswidrigkeit einer Fremdrechtsanwendung bei Strafblanketten?
2. Neues Verständnis einer Fremdrechtsanwendung bei Strafblanketten?
3. Zwischenergebnis
III.Der Bestimmtheitsgrundsatz als Vorhersehbarkeitsgewährleistung
1. Statische und dynamische Verweisungen
2. Vorhersehbarkeit der Strafe als Bestimmtheitskriterium
3. Ausnahme von den Bestimmtheitsanforderungen wegen Expertenstrafrechts?
IV. Fremdrechtsanwendung und Vorbehalt des Gesetzes
V. Ergebnis
Teil 8 Zur Fremdrechtsanwendung bei der Untreue
I. Zur Anwendbarkeit deutschen Strafrechts
II. Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des administrador wegen Untreue
III. Zum existenzgefährdenden bzw. -vernichtenden Eingriff
1. Anwendbarkeit der Existenzvernichtungshaftung auf EU-Auslandsgesellschaften?
a) Zur kollisionsrechtlichen Qualifikation der Existenzvernichtungshaftung
b) Vereinbarkeit einer entsprechenden Anwendung der Existenzvernichtungshaftung mit der Niederlassungsfreiheit?
2. Kapital- und Gläubigerschutzregelungen im spanischen Recht
3. Zwischenergebnis
IV. Verfassungsrechtliche Aspekte einer Fremdrechtsanwendung bei der Untreue
1. Hinreichende Bestimmtheit des Tatbestands bei einer Fremdrechtsanwendung?
2. Parlamentsvorbehalt
3. Vorhersehbarkeit
V. Ordre public als Obergrenze strafbaren Verhaltens?
VI. Vereinbarkeit einer Untreuestrafbarkeit des Verwalters mit der Niederlassungsfreiheit?
VII. Ergebnis
Teil 9 Praktische Bedenken einer Fremdrechtsanwendung
I. Anwendungsschwierigkeiten einer Fremdrechtsanwendung in der Praxis
II. Legislative Möglichkeiten
Teil 10 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
1
Der EuGH[1] hat durch seine Entscheidungen über die Niederlassungsfreiheit von Gesellschaften für die Praxis die Möglichkeit eröffnet, ohne Verlust der Rechtsfähigkeit den Verwaltungssitz einer europäischen Kapitalgesellschaft grenzüberschreitend nach Deutschland zu verlegen. Die daraus resultierenden weitreichenden Folgen für das Gesellschaftsrecht und im weiteren Sinne auch für das Strafrecht bildeten in der Folge bereits vielfach Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Diese Dissertation wird sich der Fremdrechtsanwendung innerhalb deutscher Wirtschaftsstraftatbestände widmen, die nunmehr daraus resultiert, dass für die strafrechtliche Beurteilung akzessorischer Merkmale ausländisches Recht deshalb zur Anwendung gelangt, da zugezogene EU-Auslandsgesellschaften nach ihrem Gründungsrecht anzuerkennen sind. Denn diese „neue“ Art der Fremdrechtsanwendung wirft in ihrer Handhabung immer noch Schwierigkeiten aus strafrechtlicher, gesellschaftsrechtlicher sowie auch europa- und verfassungsrechtlicher Sicht auf.
2
Von einer Fremdrechtsanwendung im Strafrecht wird gesprochen, wenn bei Sachverhalten mit Auslandsbezug zur Vervollständigung ausfüllungsbedürftiger Straftatbestände des nationalen Rechts auf die Rechtsordnung eines anderen Staates zurückgegriffen werden muss. Rechtstechnisch vollzieht sich die Anknüpfung an außerstrafrechtliche Begrifflichkeiten oder Rechtssätze über normative Tatbestandsmerkmale und Blankettgesetze. Kennzeichnend für diese insbesondere im Wirtschaftsstrafrecht vorherrschende Art der Verweisungstechnik ist, dass das Strafrecht als Sekundärmaterie fungiert und die Bestimmung der strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen akzessorisch aus anderen Rechtsgebieten übernimmt. Die zunächst für eine Fremdrechtsanwendung erforderliche Anwendbarkeit des allein maßgeblichen deutschen Strafrechts bestimmt sich dabei nach den Regelungen des Internationalen Strafrechts. Für zivilrechtsakzessorische Merkmale werden in Bezug auf die Bestimmung der ausländischen Rechtsordnung unterschiedliche Vorgehensweisen favorisiert, die entweder in einer direkten Heranziehung des ausländischen Tatortrechts oder einer Anknüpfung an die international-privatrechtlichen Regelungen bestehen. Dies wird im ersten Teil dieser Untersuchung näher erläutert und durch Beispiele aus der Rechtsprechung ergänzt werden.
Читать дальше