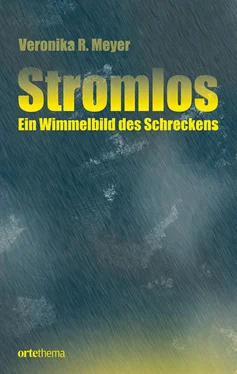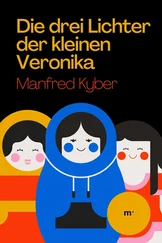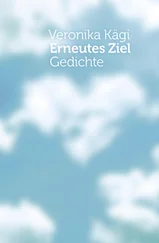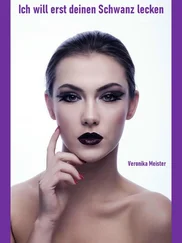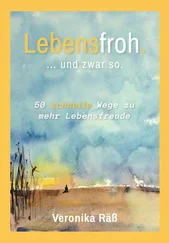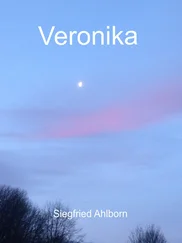In St. Gallen verfolgte Stadtpräsidentin Gisela Löpfe die Vorgänge in Mühleberg mit grösster Unruhe. War denn nicht der heutige Tag schrecklich genug gewesen? Zwei tote Mädchen wegen des Hochwassers. Dass die Feuerwehr den ganzen Nachmittag lang mit dem Auspumpen von überschwemmten Kellern beschäftigt gewesen war, hatte sie dagegen kaum zur Kenntnis genommen. Aber diese neue Katastrophe! Eine geborstene Staumauer und ein überschwemmtes, unkontrollierbares Kernkraftwerk. Eine radioaktive Wolke aus Mühleberg könnte ohne Weiteres bis nach St. Gallen reichen. Löpfe befragte das Internet und nahm zur Kenntnis, dass die Distanz bis zum Unfallort hundertsiebzig Kilometer betrug. So nahe wie jetzt hatte sie sich Bern noch nie gefühlt, pflegte sie doch sonst gerne das uralte Klischee, wonach die Ostschweiz für Bundesbern nicht existiere. Sie wünschte sich, dass die Welt hinter Winterthur, das heisst westlich davon, aufhören möge. Sollten Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung getroffen werden? Sie bestellte die Stadtregierung per Mail zu einer ausserordentlichen Sitzung am nächsten Vormittag – und nach kurzem Nachdenken gleich auch noch die sieben kantonalen Regierungsräte. Spätabends, aber immerhin noch vor Mitternacht, liess sie sich ins Bett fallen und träumte von diffus katastrophalen Ereignissen, gegen die sie ankämpfte, aber mit ihren Massnahmen immer zu spät kam; vielleicht waren es auch die falschen Massnahmen, jedenfalls warfen unidentifizierbare Bedrohungen ihre eiskalten Schatten über die Stadt und löschten alles Lebensglück aus.
Während der Nacht war es ausserordentlich schwierig, im Kernkraftwerk irgendwelche Notmassnahmen zu treffen, nicht zuletzt, weil die Anlage grösstenteils im Dunkeln lag. Nur noch wenige Notstrombatterien waren funktionsfähig, und manche Gebäude waren wegen der grossflächigen Überschwemmung kaum erreichbar. Sämtliche Untergeschosse waren überflutet. Mehrere Personen wurden vermisst. Nach der Explosion zeigten die noch verfügbaren Messgeräte steigende Strahlungswerte. Das beschädigte Reaktorgebäude durfte von ausgewählten Mitarbeitern nur kurzzeitig betreten werden, was aber ohnehin bald vom Schichtleiter verboten wurde, weil dort nichts auszurichten war. Herumliegende Trümmer hatten weitere Teile der Anlage in Mitleidenschaft gezogen, und sie erschwerten den Zugang zu kritischen Stellen. Die Devise hiess Kühlung, Kühlung, Kühlung, was aber nur einigermassen gelang, solange das Hochreservoir noch nicht leer war. Der Wasservorrat reichte bis zum Morgen, dann übernahmen Helikopter die Kühlung aus der Luft. Sie füllten ihre Tanks mit Wasser aus der nahe gelegenen Saane und entleerten sie durch die Löcher im Dach direkt in das Reaktorgebäude. Ein Pilot durfte nicht mehr als sechs Flüge durchführen, nachher wurde er vorsichtshalber ersetzt, damit seine Strahlenbelastung möglichst gering blieb.
Eine verlorene Stadt
Was während diesen Stunden und den folgenden Tagen in Mühleberg genau geschah, wird vielleicht nie vollständig aufgeklärt werden können. Jedenfalls trat am Nachmittag nach der Explosion plötzlich deutlich mehr Radioaktivität aus, was nur durch den Beginn einer Kernschmelze erklärbar war. Immerhin war die Notfallzone eins um das Werk bereits in der Nacht evakuiert worden; sie umfasste die Dörfer Mühleberg, Wileroltigen und Golaten sowie einige Weiler. Die Autobahn A1, welche mitten durch diese Zone führte, musste zwischen Frauenkappelen und Kerzers gesperrt werden.
Im Nachhinein gerieten die Schäden durch die Flutwelle in den Gebieten unterhalb von Mühleberg beinahe in Vergessenheit. Sie übertrafen alles Vorstellbare. Natürlich hatten die Bundesbehörden schon vor Jahrzehnten Szenarien für den Fall entwickelt, dass die Mühleberg-Staumauer brechen würde – wie auch für alle anderen grossen Talsperren in der Schweiz. Die Notfallpläne wurden alle paar Jahre aktualisiert und der Bevölkerungs- und Infrastrukturentwicklung angepasst. Doch dies waren Gedankenspiele, Berichte auf Papier und auf Servern. Jetzt waren diese Gedankenspiele lebendig geworden. Direkt an den Ufern des Wohlensees wohnten nur relativ wenige Menschen, die meisten davon in den Einfamilienhäusern zwischen Kappelenring und Talmatt, die übrigen in den verschiedenen Weilern. Sie alle hatten ihre Wohnungen und Häuser bereits am Morgen nach der Entstehung des Seftau-Damms verlassen müssen. Etwa um siebzehn Uhr dröhnten die Sirenen zwölfmal in den Gebieten unterhalb der Staumauer mit unheimlich tiefem Ton: Wasseralarm! Wer sich in Niederried, Kallnach, Müntschemier, ja auch in Aarberg, Lyss und Studen nicht schon während des Tages in Sicherheit gebracht hatte, musste es jetzt tun. Ein Chaos blieb erstaunlicherweise aus, was wohl dem Umstand zu verdanken war, dass die betroffenen Ortschaften nicht besonders gross waren. Trotzdem tötete die eine Stunde später anrollende Flut ein gutes dutzend Menschen, offenbar solche, die den Alarm nicht beachtet hatten oder sich nicht aus eigener Kraft aus der Gefahrenzone retten konnten. Die Wehranlagen bei Niederried stellten für die Wassermassen kein Hindernis dar, sie wurden einfach vollständig überflutet. Der Wohlensee war nach dem Durchgang der Flutwelle ein grässlich brauner, verschlammter, nahezu leerer Fjord, die Aare bis Niederried ein wütender Fluss, die Gegend weiter unten kahlgeschlagen. Ein See voller Trümmer erstreckte sich bis Aarberg, wo er sich mit den bereits vorher überfluteten Gebieten des Seelands vereinigte.
Nach der nächtlichen Explosion im Kernkraftwerk und den steigenden radioaktiven Strahlungswerten im Lauf des Nachmittags trafen sich in Bern am frühen Abend alle anwesenden Regierungsmitglieder von Bund und Kanton zu einer Katastrophensitzung: Bundespräsident Ludovic Dubied, die Bundesräte Roland Oberli, Patrick Vonarburg, die Bundesrätinnen Beatrice Fässler und Antonella Rezzonico. Bundesrat Thierry Favre befand sich zu Gesprächen in Pretoria, und Bundesrätin Marina Jauch leitete eine Wirtschaftsdelegation, die Indien besuchte. Im Schlepptau des bleichen Regierungsrats Thomas Berger trafen fünf seiner Kolleginnen und Kollegen ein, während Finanzdirektor Steuri seit einer knappen Woche in den Ferien weilte.
«Je pense que nous nous en tirons à bon compte.» – «Sind Sie wahnsinnig, Sie sind wohl der einzige, der das glaubt!» – «Ich will mich jedenfalls nicht verstrahlen lassen, ich gehe weg.» – «Sie Memme, es geht nicht um uns, es geht um den Schutz der Bevölkerung!» – «E della Svizzera.» – «Die Schweiz ist stark, sie hat noch jedes Unglück aus eigener Kraft bewältigt.» Das war keine geordnete Sitzung, denn jedermann hatte Angst, ob zugegeben oder nicht. Einige klammerten sich an Vertuschungsfantasien und Durchhalteparolen, andere sahen das Land in ein schwarzes Loch aus Strahlung, Chaos und wirtschaftlichem Niedergang stürzen. Die neusten Strahlenwerte, welche aus Mühleberg gemeldet wurden, waren hoch, aber nicht katastrophal; lokal wurden bis 0,005 Millisievert pro Stunde gemessen. «Il faut évacuer Berne!» – «Und Biel und Fribourg auch!» – «Jetzt sind Sie alle wahnsinnig, das ist doch gar nicht machbar. Und wenn die Leute ein bisschen Strahlung abbekommen, so wirkt sich das erst in vielen Jahren aus. Krebs hat es schon immer gegeben und wird es immer geben.» – «Die haben doch alle Jodtabletten erhalten, jetzt können sie diese mal ausprobieren.» Bundesrätin Rezzonico fiel beinahe in Ohnmacht und sagte nichts mehr. Die Stimmung wurde immer gereizter, gleichzeitig schlich sich blankes Entsetzen ein. Bundespräsident Dubied erschrak zutiefst ob dem Gedanken, dass in seinem Präsidialjahr die Stadt Bern, ein Unesco-Weltkulturjuwel aus grauem Sandstein, aufgegeben werden müsste, wie auch eine Reihe weiterer Städte. Dieses Szenario war nicht auszuhalten, und er vertagte die Sitzung auf den nächsten Morgen in der Hoffnung, dass sich die Situation in Mühleberg nach und nach beruhigen würde.
Читать дальше