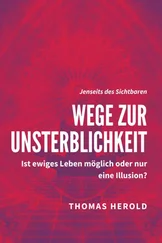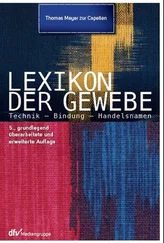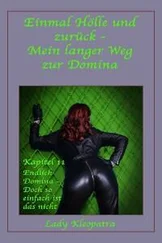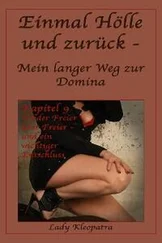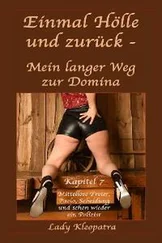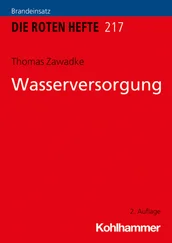1.4 Schutzkleidung für Flughelfer
Auch an die Bekleidung eines Flughelfers werden spezielle Anforderungen gestellt. So sollte der Träger gut erkennbar sein (möglichst auffällige Signalfarbe) und die Kleidung möglichst eng anliegen, um beim Downwash durch den Hubschrauber nicht zu »flattern« oder den Träger bei der Arbeit zu behindern. Sie muss auch genügend Bewegungsfreiheit zulassen, da in allen Körperlagen (gebückt, kniend, liegend) gearbeitet werden muss.
[27]Um jederzeit ansprechbar zu sein und die Kommunikation mit dem Piloten sicherzustellen, müssen die Flughelfer über Sprech-/Hörgarnituren für den Funk im Helm verfügen, auch um die Hände für die erforderlichen Arbeiten frei zu haben.

Bild 6: Flughelfer bei der Arbeit unter dem schwebenden Hubschrauber
[28]1.5 Absturzsicherung in Hanglagen
Sobald Absturzgefahr der Einsatzkräfte besteht, müssen adäquate Maßnahmen umgesetzt werden. Arbeiten unter diesen Umständen sind in der Regel nur bei Nachlöscharbeiten (englisch: mop up) sinnvoll. Da in der Regel immer von oben gearbeitet wird, muss das Feuer sicher eingedämmt bzw. gelöscht sein. Ansonsten besteht Lebensgefahr bei Flammen unterhalb der Abseilstelle. Arbeiten in der Nacht sollten auch die absolute Ausnahme sein, obwohl diese bei einer »normalen« Brandbekämpfung im flachen Gelände oft bevorzugt wird (in der Nacht ist es kühler, die Glutnester sind besser zu erkennen usw.). Die Brandbekämpfung sowie Nachlöscharbeiten in der Nacht dürfen daher nur nach Arbeiten tagsüber im gleichen Gebiet oder nach erfolgter Erkundung am Tag durchgeführt werden.
Das Anbringen von »Geländerseilen« horizontal oder vertikal, kann zur Einzelsicherung der Kräfte sehr effektiv sein. Dabei kann das aktive oder passive Abseilen angewendet werden. Arbeiten am hängenden Seil sind möglichst zu vermeiden. Zum sicheren Arbeiten mit Werkzeugen muss immer Bodenkontakt (mit den Füßen) bestehen. Die Anforderung an einen Festpunkt sind mindestens 10 kN (1 Tonne Haltekraft). Dazu können z. B. Felsen, Strukturen oder Bäume dienen (Fahrzeuge sind dazu ungeeignet!). Bäume müssen gesund sein und einen Brusthöhendurchmesser von mindestens 30 cm aufweisen. Arbeiten im absturzgefährdeten Bereich sind aber nur durch entsprechend ausgebildete Kräfte (Rope-Squads oder Bergwacht mit Sonderausbildung) und mit entsprechen[29]dem Material auszuführen. Als Sicherungseile sollten nur Kevlarseile (diese sind hitzebeständiger!) verwendet werden.
Bei Arbeiten mit Tools, Handwerkszeug oder Kettensägen muss zwingend ein »Vorfach« aus Stahlseil verwendet werden. D. h. es muss von der arbeitenden Person bis zum Sicherungsseil ein Stahlseil (Seilstropp) mit ca. 2 m Länge eingebaut werden, um sicherzustellen, dass beim Ausrutschen oder versehentlichen Berühren mit dem Werkzeug oder der Kettensäge das Seil nicht durchtrennt werden kann.
Es muss bei Arbeiten am Berg/am Hang auch die Kameradenrettung aus schwierigem Gelände im Blick behalten werden. Daher ist genügend zusätzliches Material und Personal vorzuhalten und erfahrene Spezialkräften (Bergführer, Bergretter, Forstfachleute usw.) zur Sicherung bereit zu stellen. [30]Mehr Informationen dazu sind im Bericht »Gebirgsbrandbekämpfung – Einsatz in schwierigem Gelände« in der BRANDSchutz/Deutsche Feuerwehr-Zeitung Ausgabe 10/2017 ab Seite 803 zu finden.

Bild 7: Hier ist das Prinzip des »Vorfaches« in Form eines Seilstropps (zur besseren Darstellung gewickelt dargestellt) zwischen Halteseil und Sitz- oder Brustgurt dargestellt.
1.6 Atemschutz, Filtergeräte
Bei Vegetationsbränden werden die üblichen Brandgase beim Abbrand organischer Stoffe freigesetzt, wenn nicht von »wilden Müllkippen« ausgegangen werden muss. Dazu entstehen noch Ruß, Asche sowie mitgerissene Schwebteilchen (Staub). Die Menge und Gefährlichkeit dieser Stoffe ist für viele Einsatz- bzw. Führungskräfte schwer einzuschätzen und wird oft über- oder unterschätzt. Es muss nicht grundsätzlich mit umluftunabhängigen Atemschutz gearbeitet werden.
[31]Neben dem richtigen taktischen Vorgehen (mit dem Wind!) sind Filtergeräte meist ausreichend.
Dazu gibt es entsprechende Atemfilter (spezielle Tücher mit einer Filterfunktion, Halbmasken oder ggf. auch Vollmasken mit Filter), wenn es nicht gelingt, die Brandrauch-Belastung der Einsatzkräfte grundsätzlich zu vermeiden. FFP2- und FFP3-Maske sind im Normalfall schon ausreichend, um Staub, Aschepartikel und Glutteilchen fernzuhalten.

Bild 8: Links: Beispiele von Partikelfiltermasken; rechts: eine für die Vegetationsbrandbekämpfung entwickelte Filtermaske, passend zur geschlossenen Schutzbrille der Firma Vallfirest (Foto: Vallfirest)
Auch CO-Warner können eingesetzt werden. Die Erfahrungen bzw. Versuche zeigen aber, dass diese bereits sehr früh ansprechen, auch wenn die Einsatzkraft beispielsweise nur in einer Rauchfahne außerhalb des kritischen Bereichs steht. Dies führt eher zur Verunsicherung als zum korrekten Einschätzen der Situation. Trotzdem sollten diese z. B. durch eine Person im Trupp getragen werden und auf höherer Warnstufe eingestellt sein.
Beim Pump-and-Roll-Betrieb mit einem Fahrzeug zum Ablöschen eines Feuersaums ist es sinnvoll, in der Kabine des Fahrzeugs einen CO-Warner mitzuführen. Hier wird empfohlen, dass alle Fenster geschlossen sind und die Lüftung auf Umluft zu stellen ist, damit keine Rauchgase in die Kabine eingesaugt werden. Trotz dieser Maßnahmen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine CO-Konzentration in der Kabine ansammelt. Der Fahrer kann so frühzeitig gewarnt werden.
[32]1.8 Getränkeversorgung
Um eine Dehydrierung zu vermeiden, sollten Einsatzkräfte bis zu einem Liter Flüssigkeit (Mineralwasser ohne/wenig Kohlensäure, Apfelschorle – keine alkoholischen Getränke) pro Stunde in mehreren kleinen Portionen trinken. Einsatzkräfte müssen hierzu regelmäßig abgelöst werden oder mit Feldflaschen/Trinksystemen ausgestattet sein.
 |
Praxis-Tipp: Wenn Getränke auf Fahrzeugen mitgeführt werden, ist es einfacher und sicherer anstelle großer Glasflaschen, kleinere (0,5 l) PET-Flaschen mitzuführen, die im Einsatzfall auch mal in einer Jackentasche oder Pattentasche der Hose verstaut werden können. |
Sollten Trinksysteme in Backpacks (wie sie z. B. Marathonläufer verwenden) eingesetzt werden, muss auf die hygienischen Verhältnisse geachtet werden. Bewährt haben sich auch Schlauch-Trink-Systeme, die an ganz normalen PET-Flaschen angeschraubt werden können. Der Vorteil liegt, neben dem deutlich geringeren Preis in der leichten Reinigung und der Verwendung immer frischer Flaschen.
Schlauch-Trink-Systeme haben gegenüber den einfachen Flaschen den Vorteil, dass die Arbeit nicht durch Entnahme der Flaschen aus den Taschen oder Rucksäcken unterbrochen werden muss und somit auch sichergestellt ist, dass immer kontinuierlich Flüssigkeit aufgenommen wird.
Читать дальше