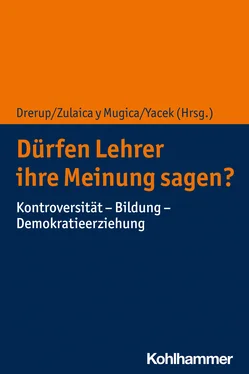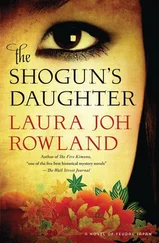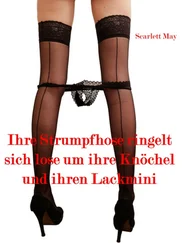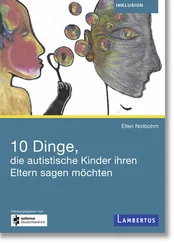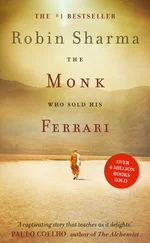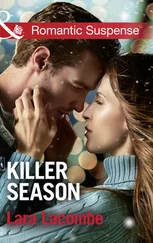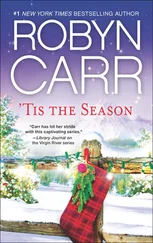In diesem Beitrag möchte ich die Frage in den Mittelpunkt stellen, wie das Kontroversitätsgebot schulischen Unterrichts aus pädagogischer Perspektive interpretiert werden kann. In einem ersten Schritt werden die erziehungs- und bildungstheoretischen Voraussetzungen erläutert, die einen pädagogischen Blick auf Sachverhalte eröffnen (1. Abschnitt). In einem zweiten Schritt wird die pädagogische Perspektive eingenommen. Dies bietet die Möglichkeit, schulischen Unterricht als erziehenden Unterricht, genauer: als einen erziehenden Unterricht mit Bildungsanspruch in den Blick zu nehmen (2. Abschnitt). Erkennt man eine solche Ausrichtung von Unterricht als maßgeblich an, so erweist es sich nicht als überzeugend, für die Position zu votieren, jeden öffentlich kontrovers diskutierten Sachverhalt im Kontext von Schulunterricht mit offenem Ausgang zu thematisieren. In einem dritten Schritt werden deshalb zwei Kriterien vorgeschlagen, die in ihrer Kombination eine spezifische Umgrenzung des Spektrums an öffentlich kontrovers diskutierten Fragen erlauben sowie jeweils in Bezug auf den Bildungsanspruch von Unterricht gerechtfertigt werden können (3. Abschnitt).
1 Ein pädagogischer Blick
Menschen – dies ist die Grundprämisse der folgenden Überlegungen – sind imperfekte, d. h. unfertige Wesen, die in der Notwendigkeit existieren, praktisch tätig zu werden. Indem Menschen handeln, bringen sie Kultur hervor, wobei Kultur hier in einem weiten Sinne verstanden wird. Diese geht nicht in Literatur, Kunst, Philosophie oder Religion auf, sondern umfasst u. a. auch Naturwissenschaft, Technik, Politik oder Wirtschaft. Indem Menschen kulturschaffend tätig sind, wenden sie ihre Imperfektheit, ohne sie aufheben zu können. Erziehung kann vor diesem Hintergrund als Reaktion auf ein spezifisches Dauerproblem menschlichen Lebens und Zusammenlebens begriffen werden. Dieses Dauerproblem besteht darin, dass Kultur nicht vererbt wird, sondern – und dies auch immer wieder neu – vermittelt und angeeignet werden muss. Erziehung lässt sich von daher als diejenige Form des Miteinanderumgehens verstehen, in der Menschen anderen Menschen dabei helfen, Kultur zu erlernen. In diesem Sinne reagiert Erziehung auf das Mortalitätsproblem – Kultur muss tradiert werden – und das Natalitätsproblem – Menschen müssen in Kultur eingeführt werden – gleichermaßen (vgl. Sünkel 2013).
Im Zuge der gesellschaftlichen Transformationsprozesse, wie sie in Mitteleuropa insbesondere seit dem 18. Jahrhundert beobachtet werden können, und die wir heute allgemein als Prozesse der Modernisierung westlicher Gesellschaften beschreiben, kristallisiert sich in pädagogischen Entwürfen dieser Zeit zunehmend die Überzeugung heraus, dass Erziehung nicht darin aufgehen dürfe, Heranwachsende in Kultur einzuführen, sondern dieser darüber hinaus eine spezifische Aufgabe zukommen müsse, nämlich Neuankömmlingen in dieser Welt dabei zu helfen, sich zu tradierten Geltungsansprüchen in ein Verhältnis zu setzen. Die Idee, dass Erziehung auf die Freisetzung für ein Leben in Selbstbestimmung gerichtet sein soll, erfährt in den pädagogischen Entwürfen der sogenannten ›Sattelzeit‹ (Koselleck) ihren Durchbruch. Erziehung wird nun fortschreitend an den Anspruch geknüpft, Bildung zu ermöglichen. Erziehung als Ermöglichung von Bildung zu begreifen, bedeutet nichts anderes, als Erziehung an »die mit dem Bildungsbegriff gesetzte Norm« der »personalen Autonomie« zu knüpfen (Blankertz 2000, S. 42).
Eine derart ausgerichtete Erziehung kann als nichtaffirmativ bezeichnet und von Spielarten einer affirmativen Erziehung unterschieden werden. Erziehung als Ermöglichung von Bildung zu begreifen, bedeutet nämlich, Heranwachsende nicht auf eine spezifische Ordnung hin festzulegen – mag es sich hierbei um eine gegebene Ordnung, mag es sich hierbei um eine stellvertretend antizipierte Ordnung handeln. Nichtaffirmative Erziehung in diesem Sinne unterscheidet sich von einer affirmativ-bewahrenden und einer affirmativ-emanzipativen Erziehung jeweils dadurch, dass Heranwachsende zu eigenem Urteil sowie zu einem über eigene Urteilsbildung vermittelten Handeln aufgefordert werden (vgl. Benner 1988/1995, S. 150).
Die Frage, was im Leben und Zusammenleben vorgezogen bzw. zurückgestellt werden soll, wird im Kontext einer nichtaffirmativen Erziehung als eine Frage behandelt, die nicht schon vor aller Erziehung ihre Beantwortung erfahren hat, so dass Erziehung nur mehr bereits gefundene Antworten zu tradieren hätte. Nichtaffirmative Erziehung tradiert die besagte Frage vielmehr als Frage, d. h. sie ist darauf gerichtet, die Heranwachsenden in die Suche nach Orientierung eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens selbst hineinzuziehen. Dies schließt mit ein, die Heranwachsenden zu einer Auseinandersetzung mit Antworten zu veranlassen, die Menschen in der Geschichte auf ihrer Suche nach Orientierung bereits gefunden haben. Diese Antworten geben allerdings nicht das Maß vor, an dem Erziehung auszurichten wäre, sondern avancieren in der Erziehung selbst zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Erziehung in diesem Sinne nimmt ihren Ausgang zwar von gesellschaftlichen Erwartungen, die an den Nachwuchs adressiert werden, affirmiert diese jedoch nicht, sondern behandelt sie als Bestimmungen, die Menschen hervorgebracht haben, und die gerade deshalb, weil Menschen imperfekte Lebewesen sind, zukünftig erneut zu Gegenständen und Ausgangspunkten der Wechselwirkung von Mensch und Welt werden können. Dies impliziert die Möglichkeit, dass die Heranwachsenden Traditionen auf eigene Art und Weise transformieren.
Die »Eigenlogik der Erziehung« in diesem Sinne zu verstehen, heißt, diese als eine Form des Miteinanderumgehens zu begreifen, die darauf gerichtet ist, »bildende Wechselwirkungen durch edukative Unterstützungen möglich zu machen« (Benner 2019, S. 322). Eine Erziehung, die darauf gerichtet ist, Bildung zu ermöglichen, geht folglich nicht darin auf, Heranwachsende in kulturelle Sachverhalte einzuführen, sondern fordert diese zu einer Prüfung tradierter Geltungsansprüche auf. Dies darf nicht relativistisch missverstanden werden, sondern schließt mit ein, dass Heranwachsende mit einer widerständigen Welt konfrontiert werden, um Differenzerfahrungen zu provozieren, die Anlass dazu sein können, bereits entwickelte Festlegungen auf den Prüfstand zu stellen und unter Umständen zu transzendieren. Umgekehrt geht Erziehung nicht darin auf, Heranwachsende mit einer widerständigen Welt zu konfrontieren, sondern impliziert immer auch, diesen die Möglichkeit zu eröffnen, im Durcharbeiten von Differenzerfahrungen eigene Positionen zu entwerfen.
Ich werde im Folgenden nicht der Frage nach der Rechtfertigung einer Beschreibung von Erziehung als Ermöglichung von Bildung nachgehen (vgl. Rucker 2019). Der Fokus der Überlegungen liegt allein auf der Frage, wie das Kontroversitätsgebot schulischen Unterrichts formuliert und begründet werden kann, wenn man die mit einer solchen Beschreibung von Erziehung verknüpfte Normativität als maßgeblich voraussetzt. Ehe ich mich dieser Problemstellung direkt zuwende, ist es zunächst erforderlich, Unterricht als eine spezifische Grundform von Erziehung auszuweisen, die als solche ebenfalls unter dem Anspruch steht, Bildung zu ermöglichen.
2 Erziehender Unterricht mit Bildungsanspruch
Unterricht, der als Ermöglichung von Bildung begriffen wird, muss bestimmten Ansprüchen genügen – dies jedenfalls dann, wenn man Bildung als einen Prozess der Entwicklung von Selbstbestimmungsfähigkeit in der Auseinandersetzung mit einer widerständigen Welt versteht. Bildung bedeutet dann, dass eine Person lernt, ihr Leben selbstbestimmt zu führen, wobei ein solcher Prozess u. a. die Entwicklung sachlicher Einsichten, eigener Urteile sowie der Fähigkeit, den eigenen Urteilen im Handeln zu entsprechen, impliziert (vgl. Rucker 2020, S. 56ff.). Von einer selbstbestimmten Lebensführung, so die Annahme, kann nur dann sinnvoll gesprochen werden, wenn ein Mensch nach eigenen Urteilen handelt. So würden wir nicht von Selbstbestimmung sprechen, wenn jemand zwar eigene Urteile entwirft, jedoch nicht dazu in der Lage ist, diesen Urteilen im Handeln zu entsprechen, d. h. sein Leben tatsächlich im Lichte der jeweiligen Urteile zu führen. Ein Handeln nach eigenen Urteilen beruht selbst wiederum darauf, dass ein Mensch überhaupt eigene Urteile fällen kann. So würden wir auch dann nicht von Selbstbestimmung sprechen, wenn jemand Positionen zustimmt bzw. Positionen ablehnt, ohne diese auf ihre Überzeugungskraft hin zu prüfen. Schließlich setzt eigene Urteilsbildung sachliche Einsichten voraus. Wie wollte man sich im Verhältnis zu einem Sachverhalt positionieren, ohne sich dabei auf Wissen über den jeweiligen Sachverhalt stützen zu können? Auf eine Formel gebracht: »Bildung« ist »Wissen« von Kultur »plus Selbstanwendung«, und damit ein Prozess, in dem ein Mensch »im Blick auf seine eigene Kultur sich als urteilendes und handelndes Subjekt ins Spiel bringt« (Brüggen 1999, S. 60).
Читать дальше