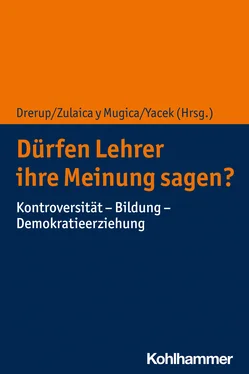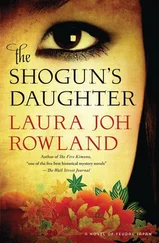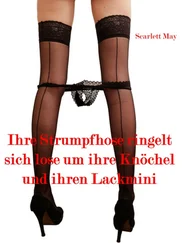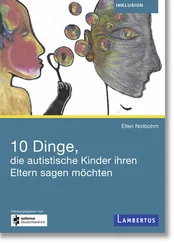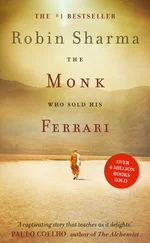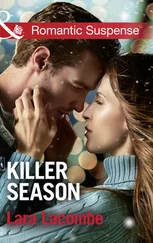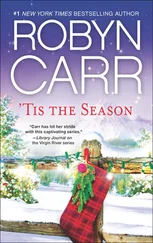Vor diesem Hintergrund ist ein Unterricht mit Bildungsanspruch konsequenterweise als ein erziehender Unterricht zu konzipieren, in dem Schüler/innen sich nicht nur sachliche Einsichten aneignen sollen, sondern auch die Möglichkeit erhalten, die Bedeutung des Gelernten für das eigene Leben im Umgang mit Anderen zu erwägen. Dies ist deshalb angezeigt, weil ein Unterricht mit Bildungsanspruch auf eine Freisetzung der Heranwachsenden für ein Leben in Selbstbestimmung gerichtet ist, das Wissen, das im Unterricht vermittelt und angeeignet werden soll, als solches in seiner Bedeutung für die Lebensführung von Heranwachsenden jedoch indifferent ist. Soll es nicht dem Zufall überlassen bleiben, ob Schüler/innen angeeignetes Wissen auf die eigene Lebensführung beziehen, so folgt hieraus, dass die Frage nach der Bedeutung unterrichtlich vermittelten und angeeigneten Wissens selbst zum Thema des Unterrichts avancieren muss (vgl. Rucker 2019, S. 649ff.).
Ein Unterricht mit Bildungsanspruch geht demzufolge nicht in einer Hinführung zum Wissen auf, sondern ist darauf bezogen, Heranwachsende zu einer selbstbestimmten Lebensführung zu befähigen, was die Unterstützung der Entwicklung eigener, mit der Freiheit anderer Menschen abgestimmter Positionen einschließt. Umgekehrt sind die Positionen, deren Entwicklung initiiert und unterstützt werden soll, über eine Aneignung von Wissen vermittelt. Die Schüler/innen sollen dazu befähigt werden, sich im Lichte sachlicher Einsichten zu Fragen eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens zu positionieren.
Es ist der Entwurf von Werturteilen, der die Verbindung zwischen einem fachlichen Wissen und der Lebensführung von Heranwachseden stiftet. Vor diesem Hintergrund kann erziehender Unterricht an der öffentlichen Schule auch als wertorientierter Fachunterricht begriffen werden – als ein Unterricht, in dem Schüler/innen dazu veranlasst werden, an das Gelernte die Frage nach dessen Bedeutsamkeit für die eigene Lebensführung zu richten sowie umgekehrt bereits entwickelte Werturteile im Lichte sachlicher Einsichten einer Prüfung zu unterziehen. Dieser Anspruch ist nicht auf bestimmte Fächer restringiert, sondern markiert eine »fachübergreifende und fächerverbindende Aufgabenstellung«, die generell berücksichtigt werden will, sollen »Wissen, Haltung und mögliches Handeln« aufeinander bezogen und damit die »Bildung der Schüler« unterstützt werden (Rekus 1993, S. 196). Pointiert formuliert: »Unterricht ist unter pädagogischer Perspektive nur ›vollständig‹, wenn er das zu erwerbende Wissen mit der (Wert-)Haltung der Schüler in Beziehung setzt und so zu einer verantwortungsvollen Lebensführung beiträgt« (ebd., S. 199).
Erziehender Unterricht kann von daher als Einheit der Differenz von Unterricht und Werterziehung verstanden werden. Jedoch verlangen beide Momente nach einer spezifischen Auslegung, um einen erziehenden Unterricht mit Bildungsanspruch unterscheidbar zu halten von einem erziehenden Unterricht, der z. B. als eine Kombination von Wissensvermittlung und konditionierender Haltungserziehung begriffen wird. Im Lichte des Bildungsanspruchs wären sowohl das unterrichtliche Moment als auch das werterzieherische Moment eines erziehenden Unterrichts in einem nichtaffirmativen Sinne zu bestimmen.
Erziehender Unterricht führt Schüler/innen in tradiertes Wissen ein, indem diesen eine Sache zunächst einmal fragwürdig und zugänglich gemacht wird, sie ausgehend von ihren Fragen zu einer Vertiefung in und einer Besinnung auf die jeweilige Sache angehalten werden, und sie schließlich darin Unterstützung erfahren, Antworten auf ihre Fragen selber denkend hervorzubringen. Indem Schüler/innen – edukativ veranlasst und unterstützt – Fragen stellen und Antworten suchen, eignen sie sich nicht nur Wissen über einen Sachverhalt an, sondern auch über die Fragen, auf die ein Wissen Antwort gibt, und schließlich auch über den Weg, der zum Wissen führt. Unterricht in diesem Sinne kann als eine Einladung begriffen werden, ein bestimmtes Wissen als eine überzeugende Antwort auf eine bestimmte Frage einzusehen und damit den verbundenen Geltungsanspruch in Freiheit zu akzeptieren. »Der Lernende soll aufnehmen und behalten, d. h. er soll lernen in der elementaren Bedeutung dieses Wortes, aber annehmen, d. h. für wahr halten, soll er das Gelernte nur unter dem Begleitschutz seines prüfenden und begründenden Denkens« (Koch 2015, S. 71; Herv. i. O.).
Jedoch geht ein erziehender Unterricht nicht darin auf, dass Schüler/innen etwas lernen; sie sollen darüber hinaus die Möglichkeit erhalten, sich zu Gelerntem zu verhalten, und zwar ohne dass dieses Sich-Verhalten bereits vorab auf einen bestimmten Umgang mit dem Gelernten hin finalisiert ist. Zugespitzt formuliert lautet die Aufgabe also, »nicht zu Werten, sondern zum Werten zu erziehen« (Schilmöller 1994, S. 350; Herv. i. O.). Damit ist wiederum nicht gemeint, dass Heranwachsende nicht in überkommene Werte eingeführt werden sollten. Im Gegenteil: Lehrer/innen präsentieren und repräsentieren diese Werte, sie sollen dies aber nicht so tun, dass Geltungsansprüche durchgesetzt werden. Die Schüler/innen sollen auch in Fragen eines gelingenden Lebens und Zusammenlebens zur Prüfung von Geltungsansprüchen aufgefordert werden, damit diese die Möglichkeit erhalten, ihre Perspektive ins Spiel zu bringen, um in der Auseinandersetzung mit tradierten Werten eine eigene Werteorientierung entwickeln und diese schließlich auch intergenerationell beraten zu können. Erziehender Unterricht in diesem Sinne bedeutet ein Hineinziehen der Schüler/innen in eine Praxis des Gründe-Gebens und Nach-Gründen-Verlangens, in der überhaupt erst eine »begründete Ablehnung oder Anerkennung« (ebd., S. 352) von tradierten Geltungsansprüchen möglich ist.
3 Das Kontroversitätsgebot
Mit diesen Erläuterungen sind die Voraussetzungen geschaffen, um im Folgenden einen pädagogischen Interpretationsvorschlag für das Kontroversitätsgebot zu entwickeln. Die Problemstellung lautet, welche öffentlich kontrovers diskutierten Sachverhalte in einem erziehenden Unterricht mit Bildungsanspruch als kontrovers, d. h. mit offenem Ausgang, thematisiert werden sollten. 2
Ehe ich direkt zu dieser Frage Stellung nehme, sind zunächst drei knappe Vorbemerkungen erforderlich. Diese sind auf grundlegende Differenzen bezogen, die im Blick behalten werden sollten, wenn eine pädagogische Auslegung des Kontroversitätsgebots unternommen wird.
(1) Sachverhalte können im Unterricht direktiv oder nichtdirektiv thematisiert werden. Direktiv ist ein Unterricht dann ausgerichtet, wenn ein Sachverhalt mit Überzeugungsabsicht thematisiert wird. Das bedeutet, ein Inhalt wird als geklärt behandelt. Lehrer/innen versuchen, Schüler/innen zu der einen richtigen Antwort auf eine bestimmte Frage zu führen. Die Einzelne soll sich die richtige Position aneignen. Nichtdirektiver Unterricht bedeutet demgegenüber, einen Sachverhalt ohne Überzeugungsabsicht zu thematisieren. Das heißt, ein Inhalt wird als offen behandelt. Lehrer/innen versuchen, Schüler/innen in den Streit um die richtige Antwort auf eine bestimmte Frage einzuführen. Die verschiedenen Positionen, die in diesem Zusammenhang eingenommen werden, sollen dabei so neutral wie möglich behandelt werden. Die Einzelne soll die verschiedenen Positionen und ihre Begründungen verstehen, eine eigene Position im Lichte widerstreitender Alternativen entwickeln sowie diese gegen Einwände verteidigen lernen (vgl. Hand 2008, S. 213).
Es gilt an dieser Stelle festzuhalten, dass sowohl direktiver als auch nichtdirektiver Unterricht mit dem Anspruch kompatibel sein können, Heranwachsende zur Selbsttätigkeit aufzufordern, d. h. diesen Mitwirkungsmöglichkeiten in der Entwicklung von Wissen und Haltung zu eröffnen. Unterricht als Aufforderung zur Prüfung von Geltungsansprüchen zu begreifen, verlangt nicht danach, Unterricht entweder direktiv oder nichtdirektiv auszurichten. Umgekehrt können direktiver und nichtdirektiver Unterricht so angelegt sein, dass Schüler/innen nicht zu einer selbsttätigen Auseinandersetzung aufgefordert werden.
Читать дальше