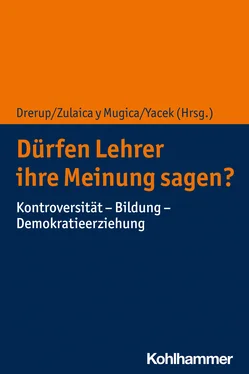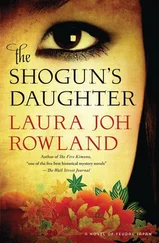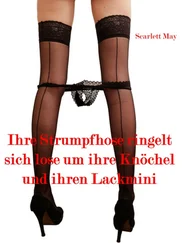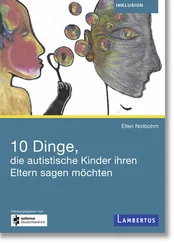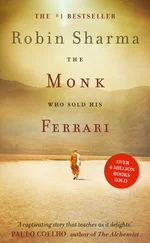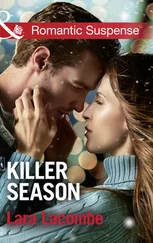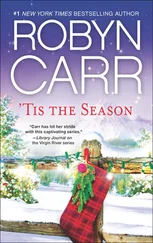Zum einen könnten Lernende den Eindruck gewinnen, dass es nicht vertretbar ist, in solchen Fällen eine eigene Meinung zu haben, da diese stets rational infrage gestellt werden kann. Manche der Lernenden werden geneigt sein, ein ausgewogenes Verständnis des jeweiligen Problems anzustreben, in dem Pro- und Kontraargumente einander gegenübergestellt werden, es aber nicht zu einem persönlichen Positionsbezug kommt.
Zum anderen könnte sich die Sichtweise durchsetzen, dass persönliche Meinungen aufgrund einer arbiträren Festlegung entstehen, die nicht weiter begründbar ist. Lernende haben in diesem Fall vielleicht keine Mühe, eine eigene Meinung zu bilden, sehen aber nicht ein, dass sie diese verständlich machen und begründen sollten. Sie betrachten Diskussionen primär als Meinungsaustausch, nicht als Prozess des gemeinsamen Abwägens von Gründen.
Indem die Lehrperson ihre Meinung mitteilt und mit Gründen unterstützt, modelliert sie, was vernünftige Meinungsbildung bedeuten kann. Dabei verdeutlicht sie, dass ihre Meinung nicht die einzig vernünftige ist, macht aber auch klar, warum sie von ihrer eigenen Meinung dennoch überzeugt ist. Sie will die Lernenden nicht von ihrer Meinung überzeugen, sondern sie zur Entwicklung ihrer eigenen Meinung und ihres gesamten Systems von Werten und Überzeugungen anregen.
Einleitend habe ich zwei Extrempositionen zur Frage, ob Lehrpersonen ihre Meinung sagen sollen, umrissen: Die eine Auffassung ist, dass Lehrpersonen die ihnen als Bürgerinnen und Bürger zukommende Redefreiheit mit dem Eintritt ins Klassenzimmer nicht verlieren. Man kann wohl davon ausgehen, dass die Übernahme des Status einer Lehrperson nicht mit dem Verlust grundlegender staatsbürgerlicher Rechte einhergeht. Folgt man den Überlegungen in diesem Beitrag, so ist allerdings festzuhalten, dass die Lehrperson ihr professionelles Handeln stets an pädagogisch-didaktischen Erwägungen und Zielvorstellungen auszurichten hat. Dies gilt auch für das Mitteilen der eigenen Meinung: Die Lehrperson ist nie eine gewöhnliche Diskussionsteilnehmerin, sondern trägt die pädagogische Hauptverantwortung für das Geschehen im Klassenzimmer.
Die zweite Position – strikte Neutralität in vernünftigerweise umstrittenen Fragen – erscheint gerade aus diesem Grund unhaltbar: In manchen Situationen kann es pädagogischen Zielen dienen, wenn Lehrpersonen ihre Meinung mitteilen und begründen. Nicht jedes Mitteilen der eigenen Meinung kommt deren Vermittlung gleich. Beziehen Lehrpersonen selbst Stellung, so kann dies Diskussionen anregen und die individuelle Meinungsbildung der Lernenden unterstützen. Umgekehrt kann es Lernenden aber auch in problematischer Weise beeinflussen, die Diskussion in der Klasse sowie die Entwicklung persönlicher Positionen behindern.
Es ist zum einen eine Frage der situativen Einschätzung jeder Lehrperson, ob sie angesichts von Erwägungen dieser Art ihre Meinung sagen soll oder nicht. Zum anderen kann die Lehrperson durch die Gestaltung der Unterrichtskonstellation Einfluss darauf nehmen, wie sich ihre Meinungsäußerung auswirkt. Gelingt es ihr, eine offene Diskussionsatmosphäre zu schaffen, in der sich alle artikulieren können, wird ihre eigene Meinungsäußerung in vielen Fällen eher anregend als störend wirken.
Christman, J. (2009): The Politics of Persons. Individual Autonomy and Socio-historical Selves. Cambridge: Cambridge University Press.
Drerup, J. (2018): »Zwei und zwei macht vier.« Über Indoktrination und Erziehung. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 13 (1), 7–24.
Drerup, J. (2021): Kontroverse Themen im Unterricht. Konstruktiv streiten lernen. Stuttgart: Reclam.
Estlund, D. (2008): Democratic Authority. A Philosophical Framework, Princeton: Princeton University Press.
Giesinger, J. (2021): Kontroversität im Ethikunterricht: Das Kriterium der öffentlichen Rechtfertigbarkeit. In: M. Kim, K. Neef, J. Friedrich & T. Gutmann (Hrsg.), Werte im Ethikunterricht. An den Grenzen der Wertneutralität, Opladen: Barbara Budrich (im Druck).
Gregory, M. R. (2014): The Procedurally Directive Approach to Teaching Controversial Issues. Educational Theory, 64 (6), 624–648.
Gutmann, A. & Thompson, D. (2004): Why Deliberative Democracy? Princeton: Princeton University Press.
Hand, M. (2007). Should We Teach Homosexuality as a Controversial Issue? Theory and Research in Education, 5 (1), 69–86.
Hand, M. (2008): What Should We Teach as Controversial? A Defense of the Epistemic Criterion. Educational Theory, 58 (2), 213–228.
Hand, M. (2018). A Theory of Moral Education. London/New York: Routledge.
Hand, M. (2020): Moral Education in the Community of Inquiry. Journal of Philosophy in Schools, 7 (2), 4-20.
Hess, D. & McAvoy, P. (2015): The Political Classroom: Evidence and Ethics in Democratic Education. New York: Routledge.
Larmore, Ch. (1988): Patterns of Moral Complexity. Cambridge: Cambridge University Press.
Larmore, Ch. (1990): Political Liberalism. Political Theory, 18 (3), 339–360.
McAvoy, P. (2017): Should Teachers Share Their Political Views in the Classroom? In: B. R. Warnick & L. Stone (Hrsg.), Philosophy: Education (S. 373–383). Farmington Hills: Macmillan.
Nussbaum, M. (2011): Perfectionist Liberalism and Political Liberalism. Philosophy and Public Affairs, 39 (1), 3–45.
Peter, F. (2019): Political Legitimacy under Epistemic Constraints: Why Public Reasons Matter. In: J. Knight & M. Schwartzberg (Hrsg.), Political Legitimacy (S. 147–173). New York: New York University Press.
Rawls, J. (1993): Political Liberalism. New York: Columbia University Press.
Tillson, J. (2017): When to Teach for Belief: A Tempered Defense of the Epistemic Criterion. Educational Theory, 67 (2), 173–191.
Warnick, B. R. & Spencer D. (2014): The Controversy over Controversies: A Plea for Flexibility and for »Soft-Directive« Teaching. Educational Theory, 64 (3), 227–244.
Das Kontroversitätsgebot schulischen Unterrichts. Ein erziehungs- und bildungstheoretisch fundierter Interpretationsvorschlag
Thomas Rucker
Einleitung
In modernen Gesellschaften sind öffentliche Kontroversen an der Tagesordnung. Es scheint kaum noch Fragen zu geben, deren Beantwortung nicht neue Fragen sowie alternative Antworten provoziert. Erziehung – dies dürfte bei aller Verschiedenheit der Positionen, die auch in der Beschreibung dieses Sachverhalts ausgemacht werden können, kaum zu bestreiten sein – erfüllt die Funktion, Heranwachsende in eine Gesellschaft einzuführen. Erziehung in Form von schulischem Unterricht trägt in diesem Zusammenhang dem Umstand Rechnung, dass es Sachverhalte gibt, die in der Einheit von Leben und Lernen nicht vermittelt und angeeignet werden können, sondern auf eine künstliche Vermittlung und Aneignung angewiesen sind. Hierzu zählen auch solche Sachverhalte, die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden. Was die Rede vom Klimawandel bedeutet, wodurch dieser verursacht wird, welche Argumente für bzw. gegen einen vom Menschen verursachten Klimawandel vorgebracht werden können etc. – all dies kann nicht im alltäglichen Miteinanderumgehen der Menschen gelernt werden, sondern muss unterrichtlich vermittelt und angeeignet werden.
Versteht man unter Erziehung die Einführung von Heranwachsenden in eine Gesellschaft, und begreift man Unterricht als eine spezifische Grundform von Erziehung, so scheint es keine sinnvolle Option zu sein, öffentlich kontrovers diskutierte Sachverhalte in diesem Zusammenhang auszusparen, will man sich nicht dem Vorwurf aussetzen, die spezifische Situation des Aufwachsens in modernen Gesellschaften zu ignorieren. Um diesem Einwand zu entgehen, hätte Unterricht vielmehr dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Schüler/innen in eine Welt hineinwachsen, in der öffentliche Kontroversen über Sachverhalte typisch zu sein scheinen. Von daher stellt sich die Frage nach einem sinnvollen Umgang mit öffentlich kontrovers diskutierten Sachverhalten im Kontext schulischen Unterrichts. Hierbei wäre nicht nur zu fragen, welche dieser Sachverhalte im Unterricht überhaupt behandelt werden sollten. Darüber hinaus gilt es auch und vor allem die Frage zu klären, welche dieser Sachverhalte als kontrovers, d. h. mit offenem Ausgang thematisiert werden sollten.
Читать дальше