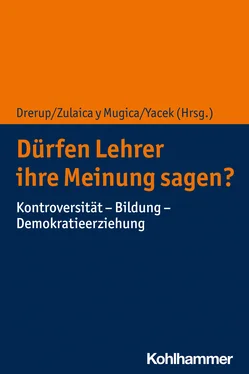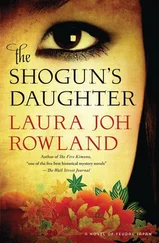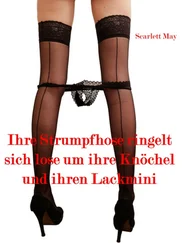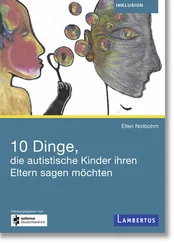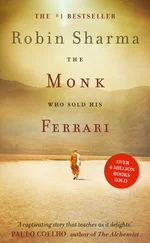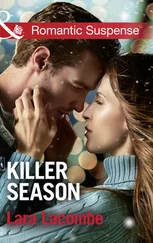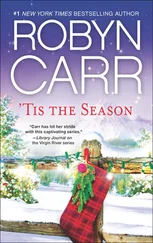Gelingende Diskussionen haben zum einen einen Eigenwert, zum anderen dienen sie unterschiedlichen Zielen, die sich teils mit den Anforderungen eines deliberativen Demokratiemodells verbinden lassen. In gut geführten Diskussionen können demokratische Grundhaltungen wie Toleranz und Respekt eingeübt werden: Die Schüler und Schülerinnen lernen idealerweise, den Auffassungen anderer in engagierter, sachlicher und fairer Weise zu begegnen. Sie können dazu angeleitet werden, andere ernstzunehmen, ihre Aussagen aber auch kritisch zu sehen und ihnen argumentativ entgegenzutreten. In der Diskussion kontroverser Themen kann Verständigung zwischen Vertretern unterschiedlicher Auffassungen geschehen, ohne dass ein Konsens angestrebt werden muss. Wichtiger ist zu erörtern, in welchen Fragen Konsens besteht und in welchen nicht.
Neben demokratischen Grundhaltungen können in diesem Kontext auch argumentative und begriffliche Kompetenzen entwickelt werden: Dies mag in lebendigen Diskussionen eine Stück weit wie von selbst geschehen, kann und soll aber durch didaktische Interventionen der Lehrperson unterstützt werden. So kann die Lehrperson die Diskutierenden dazu anregen, die verwendeten Begriffe zu klären oder ihre Argumenationsmuster genauer unter die Lupe zu nehmen.
Soll die Lehrperson sich mit ihrer eigenen Meinung einbringen? Es scheint klar, dass Meinungsäußerungen der Lehrperson Diskussionen beeinträchtigen können. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Lehrperson ihre Auffassung in kompetenter Weise rechtfertigt und sie so für die Lernenden schwer angreifbar macht. In vielen Fällen wird davon abzuraten sein, die eigene Meinung bereits in einem frühen Stadium der Diskussion zu äußern, um den Lernenden genügend Raum zur Entwicklung ihrer eigenen Argumente und Kontroversen zu lassen.
Die Mitteilung der eigenen Meinung kann aber in manchen Kontexten einer Förderung der Diskussion dienlich sein. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Lernenden untereinander »alle der gleichen Meinung sind« oder sich dies zumindest einbilden. Sind alle »für Suizidbeihilfe« oder »für aktive Sterbehilfe«, so kann es sinnvoll sein, wenn die Lehrperson ihre davon abweichende Auffassung ins Spiel bringt. In solchen Situationen ist es selbstverständlich auch möglich, die Gegenpositon als Advocatus Diaboli einzubringen oder mit den Lernenden einen Text mit einer alternativen Auffassung zu lesen. Äußert die Lehrperson ihre eigene Meinung, kann dies zur Folge haben, dass Schüler und Schülerinnen sich in besonderer Weise herausgefordert fühlen, ihre eigene Position zu rechtfertigen und zu entwickeln. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Meinung der Lehrperson sich nicht vollständig in dem den Lernenden bekannten Muster (»für oder gegen Sterbehilfe«) bewegt, sondern einen differenzierten Standpunkt ausdrückt. Das kann die Lernenden dazu bewegen, ihren Standpunkt ebenfalls zu präzisieren.
Diese Erwägungen machen deutlich, dass die Lehrperson in schulischen Diskussionen nie als einfache Teilnehmerin gelten kann, die den anderen auf Augenhöhe begegnet, sondern stets ihre pädagogisch-didaktischen Ziele im Blick haben muss, wenn sie ihre Meinung äussert oder sich damit zurückhält.
5 Sich eine eigene Meinung bilden
Standen im letzten Abschnitt demokratische Grundhaltungen und argumenative Kompetenzen im Vordergrund, geht es im Weiteren um die persönliche Meinungsbildung der Lernenden. Angenommen wird, dass es ein Ziel des Unterrichts sein sollte, die Lernenden in der Entwicklung einer eigenen Meinung zu unterstützen. Dies setzt voraus, dass Positionen zu vernünftigerweise kontroversen Fragen nicht direktiv vermittelt werden (3), erschöpft sich aber nicht darin, sondern erfordert darüber hinaus ein aktives Bemühen um pädagogische Arrangements, die die freie Meinungsbildung ermöglichen. Die Frage ist, inwiefern diesem Ziel gedient ist, wenn die Lehrperson ihre Meinung äußert.
Hier könnte man zunächst fragen, was es heißt, eine »eigene« – oder »authentische« – Meinung zu bilden. Um dieser Ausdrucksweise einen Sinn abzugewinnen, muss man sich mit einem bescheidenen Verständnis von Authentizität zufriedengeben, wie es etwa in der neueren Autonomiedebatte verwendet wird (vgl. Christman 2009): Authentisch ist die Meinung einer Person nicht nur dann, wenn sie diese selbst entwickelt oder erfunden hat. Ihre Meinung kann authentisch sein, auch wenn andere die gleiche Meinung haben. Man kann sich eine Meinung aneignen, indem man sich mit ihr identifiziert. So gesehen ist es durchaus möglich, eine Meinung aus dem sozialen und kulturellen Umfeld – z. B. von der Lehrperson – zu übernehmen und sie zu seiner eigenen zu machen. Hat eine Meinungsäußerung der Lehrperson die Wirkung, dass ihre Position von Lernenden adoptiert wird, ist nicht notwendigerweise von einer unberechtigten Beeinflussung der Lernenden auszugehen.
Allerdings scheint klar, dass nicht jede Form der Identifikation mit einer Meinung deren Authentizität sicherstellt: Meinungen können Lernenden aufgezwungen oder aufgedrängt werden. Ein Unterricht, in dem manipuliert oder indoktriniert wird, wird kaum dazu führen, dass Auffassungen, die die Lernenden annehmen, »ihre eigenen« sind. Allerdings ist es schwierig, Formen von Indoktrination oder Manipulation klar von unproblematischen Unterrichtsmethoden zu unterscheiden (vgl. Drerup 2018). Wie gesagt, ist der gewöhnliche Unterricht von Asymmetrien und Abhängigkeiten bestimmt, und Lernende sind dadurch besonders geneigt, sich den Vorgaben der Lehrperson zu unterwerfen. Trotz des machtförmigen Charakters von Unterricht scheint es jedoch möglich, eine Atmosphäre zu schaffen, in denen Lernende ihre Auffassungen in freier Weise artikulieren und entwickeln können.
Sieht man Auffassungen zu vernünftigerweise umstrittenen Fragen als begründbar an, ist klar, dass die Meinungsbildung mit dem Prüfen von Gründen einhergehen muss. Man könnte hier noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass einzelne Meinungen nicht isoliert zu betrachten, sondern mit anderen Meinungen – und letztlich dem gesamten System der eigenen Werte und Überzeugungen – in Verbindung gebracht werden sollten: Eine Meinung, die nicht zu den Meinungen passt, die jemand bereits hat, ist demnach nicht wirklich »ihre eigene«. Authentizität entsteht, wenn verschiedene Positionen, die jemand übernommen hat, aufeinander abgestimmt und zu einem mehr oder weniger kohärenten Ganzen gebildet werden. So ergibt sich ein normatives Selbstverständnis, das der Person Handlungsorientierung verschafft und sie in die Lage versetzt, sich neu auftretenden Problemen zu stellen. Sie kann sich zu diesen Themen eine Meinung bilden, die auf bisherige Auffassungen abgestimmt ist, möglicherweise aber auch gewisse Aspekte des bestehenden Selbstverständnisses modifiziert. Folgt man dieser kohärentistischen Auffassung von Authentizität, kann das Ziel von Unterricht darin gesehen werden, Prozesse der Entwicklung eines kohärenten Selbstverständnisses zu ermöglichen und anzuleiten. Dies kann etwa zu Unterrichtskonzepten führen, die die Behandlung der Sterbehilfe mit der Diskussion verwandter ethischer Fragen verknüpft und die Lernenden so dazu anregt, ihre Auffassungen zu verschiedenen Fragen miteinander in Verbindung zu bringen: Wie etwa verhalten sich die Einstellungen, die Lernende zum Suizid Jugendlicher haben, zu ihren Meinungen über Suizidbeihilfe oder aktive Sterbehilfe?
Es ist klar, dass Meinungsäußerungen der Lehrperson solche Prozesse in manchen Situationen stören oder zumindest nicht unterstützen. Allerdings kann es gute Gründe geben, zur Förderung der Meinungsbildung mit der eigenen Meinung nicht zurückhalten. Meine zentrale Überlegung zu diesem Thema hat Ähnlichkeiten mit Hands Argumentation für das epistemische Kriterium: Nach Hand (2008) sollen epistemisch geklärte Fragen direktiv vermittelt werden, weil sich bei den Lernenden ansonsten die Auffassung einschleichen könnte, dass Argumente nicht von entscheidender Bedeutung seien. Im vorliegenden Fall stehen nicht epistemisch geklärte Fragen im Mittelpunkt, sondern solche, auf die es vernünftigerweise unterschiedliche Antworten geben kann. Verhält sich die Lehrperson in diesen Fragen strikt neutral, kann dies den Anschein erwecken, als könne man sich dazu keine begründete Meinung bilden.
Читать дальше