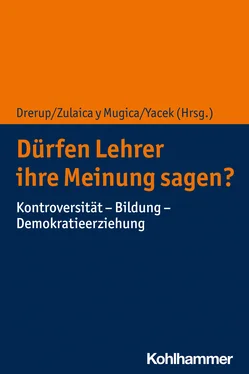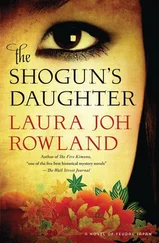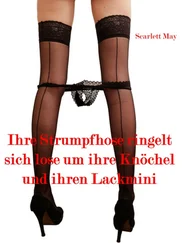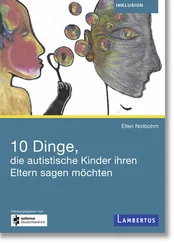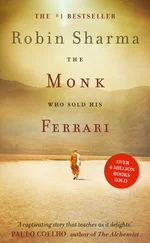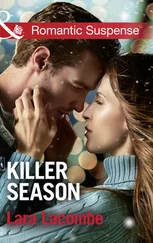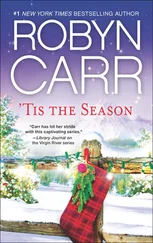Es wäre aber ebenso widersinnig, Bildung als ein Sich-Verhalten zu einer widerständigen Welt zu verstehen, Heranwachsende dann aber nicht in die Vielheit gut begründeter Positionen einzuführen. Schüler/innen zu einer spezifischen Position zu führen, obgleich es vernünftige Alternativen hierzu gibt, ist nämlich nur dadurch möglich, dass das Sich-Verhalten von Heranwachsenden unterbunden, d. h. ihnen die Möglichkeit vorenthalten wird, im Lichte jeweils gut begründeter Alternativen Stellung zu nehmen. Da im Falle von komplexen Problemstellungen keine Position mit einem Argument aufwarten kann, das absolute Durchschlagskraft besitzt, wird eine solche Erziehung zu Methoden und Mitteln greifen müssen, die das Sich-Verhalten von Schüler/innen unterminieren, um diese dazu zu veranlassen, eine bestimmte Position für gerechtfertigt zu halten (Alternativen werden verschwiegen, Positionen werden ›verzerrt‹ dargestellt, eine Person soll mittels Sympathie zur Übernahme einer Position bewogen werden etc.). Damit wird der Anspruch unterminiert, Heranwachsenden dabei zu helfen, im Lichte widerstreitender Positionen einen ›eigenen Weg zu finden und zu gehen‹. Bildung meint aber gerade nicht, Positionen unbefragt zu akzeptieren, sondern impliziert eine Prüfung von Geltungsansprüchen. Bildung zu ermöglichen, bedeutet deshalb, das Sich-Verhalten zur Welt gerade nicht zu unterminieren, sondern – im Gegenteil – zu ermöglichen. In all den Fällen, bei denen es verschiedene Positionen gibt, die jeweils mit guten Gründen vertreten werden können, sollte Unterricht deshalb nichtdirektiv ausgerichtet sind.
Ballibar, E. (2012): Gleichfreiheit. Politische Essays. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Ballauff, Th. (1993): Über die Unerlässlichkeit der Bildung. In: M. Borelli (Hrsg.), Deutsche Gegenwartspädagogik (S. 1–19). Baltmannsweiler: Schneider.
Benner, D. (1988/1995): Bildsamkeit und Bestimmung. Zu Fragestellung und Ansatz nicht-affirmativer Bildungstheorie. In: D. Benner (Hrsg.), Studien zur Theorie der Erziehung und Bildung (S. 141–159). Weinheim, München: Juventa.
Benner, D. (2019): Über die eigenlogische Normativität der Erziehung und ihre Bezüge zu anderen Normativitätsansprüchen. Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik, 95 (3), 317–332.
Biesta, G. (2017a): Politics, subjectivity and education in neoliberal times. In: E. Reimers & L. Martinsson (Hrsg.), Education and Political Subjectivities in Neoliberal Times and Places. Emergences of norms and possibilities (S. 14–30). London, New York: Routledge.
Biesta, G. (2017b): The Rediscovery of Teaching. New York, London: Routledge.
Biesta, G. (2018): A Manifesto for Education Ten Years On: On the Gesture and the Substance. Praxis Educativa, 22 (2), 37–42.
Blankertz, H. (2000): Theorien und Modelle der Didaktik (14. Auflage). Weinheim, München: Juventa.
Brüggen, F. (1999): Bildung als Orientierungsform. Bemerkungen zur Stellung der Bildung zwischen Ethik und Wissenschaft. In: A. Wenger-Hadwig (Hrsg.), Verführung in orientierungsloser Zeit (S. 43–66). Innsbruck, Wien: Tyrolia.
Hand, M. (2008): What Should We Teach As Controversial? A Defense of the Epistemic Criterion. Educational Theory, 58 (2), 213–228.
Herzog, W. (2017): Relationales Denken in Pädagogik und Psychologie. In: J. Krautz (Hrsg.), Beziehungsweisen und Bezogenheiten. Relationalität in Pädagogik, Kunst und Kunstpädagogik (S. 119–132). München: kopaed-Verlag.
Koch, L. (2015): Lehren und Lernen. Wege zum Wissen. Paderborn: Schöningh.
Lobkowicz, N. (2003): Über Werte. Studies in East European Thought, 55 (4), 367–386.
Rekus, J. (1993): Bildung und Moral. Zur Einheit von Rationalität und Moralität in Schule und Unterricht. Weinheim, München: Juventa.
Rucker, Th. (2019): Erziehender Unterricht, Bildung und das Problem der Rechtfertigung. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 22 (3), 647–663.
Rucker, Th. (2020): Teaching and the Claim of Bildung: The View from General Didactics. Studies in Philosophy and Education, 39 (1), 51–69.
Rucker, Th. (2021): Moderne Gesellschaft, nichtaffirmative Erziehung und das Problem der Kontroversität. Pädagogische Rundschau, 75 (2), 135–156.
Rucker, Th. & Anhalt, E. (2017): Perspektivität und Dynamik. Studien zur erziehungswissenschaftlichen Komplexitätsforschung. Weilerswist: Velbrück.
Schilmöller, R. (1994): Erziehender Unterricht als Problem und Aufgabe. Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik, 70 (3), 344–357.
Sünkel, W. (2013): Erziehungsbegriff und Erziehungsverhältnis. Allgemeine Theorie der Erziehung. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
Yacek, D. (2018): Thinking Controversially: The Psychological Condition for Teaching Controversial Issues. Journal of Philosophy of Education, 52 (1), 71–86.
2Im Folgenden greife ich auf Überlegungen zurück, die ich auch an anderer Stelle zur Diskussion gestellt habe (vgl. Rucker 2021).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.