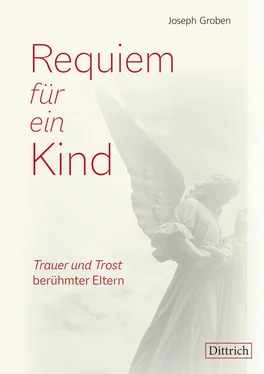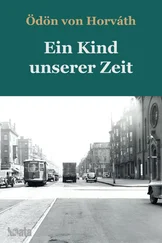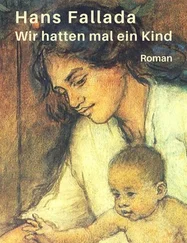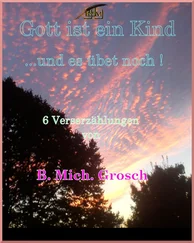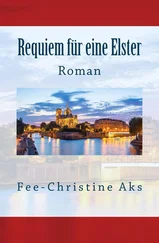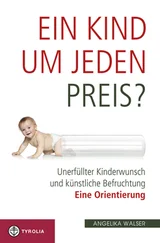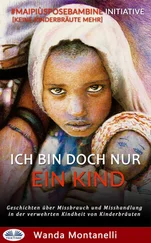Ludwig XIV. traute dem Schicksal nicht mehr. Im Jahre 1714 änderte er das Grundgesetz über die Thronnachfolge, indem er auch seine unehelichen Nachkommen als erbberechtigt anerkannte. Auch sie waren von »königlichem Blute«, und wenn es um das Überleben der Dynastie ging, glaubte der König sich zu diesem ungewöhnlichen Schritt berechtigt.
Als der Sonnenkönig sein Ende nahen spürte, erhielt er am 24. August 1715 die Sterbesakramente und nahm in seltsamer Gelassenheit Abschied von seinen Höflingen. Dann ließ er seinen fünfjährigen Urenkel an sein Sterbebett kommen, um ihm sein geistiges Vermächtnis mitzuteilen, das auch ein vernichtendes Urteil über seine Herrschaft beinhaltete: »Mein Kind, Sie werden ein großer König sein. Ahmen Sie mich nicht nach in der Freude, die ich an Gebäuden und an Kriegen hatte; bemühen Sie sich im Gegenteil, mit ihren Nachbarn in Frieden zu leben. Geben Sie Gott, was Sie ihm schuldig sind; erkennen Sie die Verpflichtungen an, die Sie ihm gegenüber haben; lassen Sie ihn durch Ihre Untertanen ehren. Folgen Sie immer den guten Ratschlägen; bemühen Sie sich, das Leben Ihrer Völker zu erleichtern, was ich nicht fertiggebracht habe und worüber ich sehr unglücklich bin.«
Als am 31. August die Sterbegebete für ihn gesprochen wurden, betete der König mit lauter Stimme das Ave Maria und das Credo. In seinen Memoiren überliefert Saint-Simon, dass die letzten Worte des Sonnenkönigs gewesen sind: »O mein Gott, komm mir doch schnell zu Hilfe!«
Ludwig XIV. starb in Versailles am 1. September 1715 im Alter von 77 Jahren. Er hinterließ ein durch seine Eroberungskriege und seine maßlose Prunksucht völlig ruiniertes Königreich. »Niemand weinte ihm eine Träne nach«, wird berichtet. Die Nachwelt vergaß schnell den ruhmvollen Titel »Louis le Grand«, den man ihm in den Glanztagen seiner Herrschaft verliehen hatte.
François Bluche: Louis XIV. Fayard. Paris 1986.
Michel de Grèce: L’envers du Soleil. Louis XIV. Paris 1979.
Nancy Mitford: Le Roi-Soleil. Gallimard. Paris 1968.
Dirk Van der Cruysse: Madame Palatine, princesse européenne. Fayard. Paris 1998.
Bernd-Rüdiger Schwesig: Ludwig XIV. Rowohlt. Reinbek 1986.
Ziegler: Les coulisses de Versailles. Paris 1963.
PETER DER GROSSE UND EUDOXIA
Der tragische Tod des russischen Thronerben ist ein untypischer Extremfall im Rahmen dieser Darstellungen. Wo sonst in der Regel ein unabwendbares und unerbittliches Schicksalsgesetz den Verlust des Kindes verursachte, stand in diesem Fall eine persönliche Entscheidung des Vaters. Vor das Dilemma gestellt, entweder sein gesamtes politisches Lebenswerk, die radikale Reformierung des russischen Imperiums, oder seinen Sohn zu opfern, glaubte sich der Zar gezwungen, der Staatsraison zu gehorchen. Er wurde damit, notgedrungen und widerwillig, selbst mitverantwortlich für den Untergang des Zarewitschs. Der ungewöhnlich komplexe Sachverhalt erfordert ein weiteres Ausgreifen der Vorgeschichte.
Nach dem Tod seines Vaters, des Zaren Alexej (1645–1676), und seines Halbbruders, des Zaren Theodor (1676–1682), wurde Peter 1682, im Alter von zehn Jahren, zum Zaren gekrönt, gemeinsam mit seinem Halbbruder Iwan. Diese Doppelherrschaft war ein Kompromiss zwischen den Familien der beiden Gattinnen des Zaren Alexej, den Miloslawskis und den Naryschkins, die einen unerbittlichen Kampf um die Macht im Kreml führten. Da beide Jungzaren aber nicht imstande waren, die Herrschaft wirklich anzutreten, setzte ihre 25-jährige Schwester Sophie, eine sehr ehrgeizige und intelligente Frau, es durch, dass sie zur Regentin bestellt wurde und so die Macht jahrelang ausüben konnte.
Kurze Zeit später ließ sie das Gerücht ausstreuen, ihr Bruder Theodor sei von der Naryschkin-Familie vergiftet worden und auch ihr Bruder Iwan sei bedroht. Daraufhin brach ein Aufstand der Strelitzen aus, der Garde des Kremls, die sich der meisten Mitglieder und Anhänger der Naryschkin-Familie bemächtigten und sie niedermetzelten. Seit der 10-jährige Thronfolger diese Schreckensszenen im Kreml erlebt und selbst um sein Leben gezittert hatte, hasste er die Hauptstadt Moskau, wo er sich nur noch ungerne aufhielt. Dieses Jugendtrauma gehörte mit zu den Gründen, die ihn später an der Ostsee eine neue Hauptstadt gründen ließen. (Ähnlich war der 10-jährige Ludwig XIV. durch den Aufstand der Fronde (1642) traumatisiert worden, was auch die Gründung der neuen Königsresidenz Versailles stark beeinflusste.)
Bis zu seinem 17. Lebensjahr hielt sich Peter fast ausschließlich auf dem Lande, in Kolomenskoje, auf und kam nur nach Moskau, um protokollarische und repräsentative Pflichten auszuüben. Er erhielt zwar keine geordnete geistige Ausbildung, aber er erlernte zahlreiche Handwerke und füllte seine Zeit mit Kriegsspielen aus. Er ließ immer neue Waffen, Kanonen und Pulver kommen und hielt wahre Manöver ab. Immer mehr junge Adlige scharten sich um ihn, unterwarfen sich einer eisernen militärischen Disziplin und bildeten schließlich zwei Regimenter von je 300 Soldaten, die den Kern der späteren Armee Peters darstellten. Auf einem See, 120 km nördlich von Moskau, baute er mit zwei holländischen Seeleuten mehrere kleine Schiffe und manövrierte mit ihnen wie mit einer Kriegsflotte. Die Regentin Sophie, die auf die Treue der 20.000 Strelitzen zählte, sah mit Nachsicht und Geringschätzung auf die »Spiele« des jungen Zaren herab.
Im August 1689, als Peter 17 Jahre alt war, kam es zur Kraftprobe zwischen den beiden »Gegnern«. Viele Strelitzen schlugen sich auf die Seite des Zaren, so dass Sophie schließlich abdanken und sich in das »Neujungfrauenkloster« bei Moskau zurückziehen musste, wo sie ihre letzten 15 Lebensjahre verbrachte.
Der Aufstieg Russlands zur Großmacht
In wenigen Jahren revolutionierte Peter den rückständigen russischen Staat. Zuerst unternahm er – »inkognito« mit einem großen Gefolge, aber schnell erkannt wegen seiner außergewöhnlichen Größe von 2 Metern – eine zweijährige Reise nach dem Westen, um alle technischen und kulturellen Errungenschaften gründlich kennenzulernen und um geschulte Spezialkräfte für seine Reformpläne anzuwerben. In Holland arbeitete er als einfacher Zimmermann auf einer Schiffswerft. Er besuchte England, Deutschland, Polen, Österreich. Um einen Zugang zum Meer zu finden, führte er jahrelang Kriege mit der Türkei, wobei ihm fast der Durchbruch zum Schwarzen Meer gelang. Der »große nordische Krieg« (1700–1721) gegen Schweden, die führende Seemacht in der Ostsee, begann mit der Niederlage von Narwa (1700). Aber in der Schlacht von Poltawa (1709) wurde der Schwedenkönig Karl XII. vernichtend geschlagen und musste in die Türkei fliehen. Beim Friedensschluss von 1721 gewann Russland große Teile der baltischen Staaten. An der sumpfigen Newa-Mündung hatte Peter schon 1703 Sankt Petersburg gegründet, die neue Hauptstadt, das »Fenster nach dem Westen«.
Russland wurde gewaltsam, gegen manche Widerstände im Adel, im Klerus und im Volk, und unter unermesslichen Opfern, zu einem modernen Imperium mit einer starken Armee, einer großen Flotte. Die übermenschliche Leistung, die größtenteils das persönliche Verdienst des Zaren war, brachte ihm 1721 offiziell den Beinamen »der Große« ein.
Die Bilanz im privaten Bereich ist weit weniger glänzend. Als Peter 17 Jahre alt war, suchte ihm seine Mutter eine Frau unter den adligen Mädchen Moskaus aus, Eudoxia Lopuchin, die drei Jahre älter war. Es wurde eine in jeder Hinsicht unglückliche Verbindung. Zwar gebar Eudoxia dem jungen Peter zwei Söhne, den Zarewitsch Alexej im Jahre 1690 und Alexander (1692), der schon nach einigen Monaten starb, aber der Zar nahm so wenig Anteil am Schicksal seiner ungeliebten Gattin, dass er nicht einmal zum Begräbnis seines jüngsten Sohnes erschien. Jahrelang mied er Eudoxia und suchte nur nach einer Gelegenheit sich ihrer zu entledigen. Als Alexej acht Jahre alt war, wurde er seiner Mutter gewaltsam entrissen, sie selbst wurde in ein Kloster nach Susdal gebracht. Zehn Monate später nahm Eudoxia den Schleier unter dem Namen Helene. So hatte Peter seine Freiheit wiedergewonnen.
Читать дальше