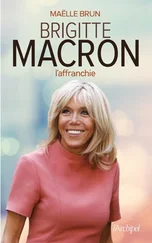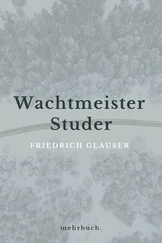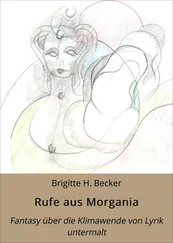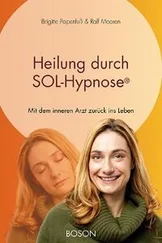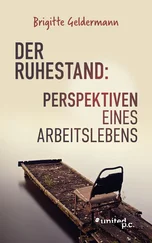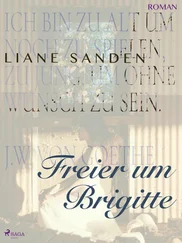Die langen 1950er-Jahre: die Suche nach Alternativtaktiken und der erste nationale Test Die langen 1950er-Jahre: die Suche nach Alternativtaktiken und der erste nationale Test 1950 gab es in Europa nur noch sieben Länder, die Frauen die politischen Rechte verwehrten: Griechenland, die Kleinstaaten Liechtenstein, Monaco, Andorra und San Marino sowie die Diktaturen Portugal und Spanien. Trotz der einsetzenden Hochkonjunktur war der Kampf für das Frauenstimmrecht in der Schweiz Ende der 1940er-Jahre festgefahren.
Die 1960er-Jahre: progressive Radikalisierung Die 1960er-Jahre: progressive Radikalisierung Die katastrophale Niederlage von 1959 war für die Schweizer Frauen ernüchternd, provozierte Wut und führte auch zu Resignation. International löste das Abstimmungsergebnis Unverständnis aus, die Menschenrechtskommission der UNO erklärte, sie habe es mit «Enttäuschung» («disappointment») zur Kenntnis genommen. 111 Der BSF bekräftigte gleichwohl sein Festhalten am eingeschlagenen Weg der sanften Überzeugungsarbeit der männlichen Stimmberechtigten. 112 Der SGF hingegen distanzierte sich von den «schmollenden Frauenstimmrechtlerinnen». 113
Die Akteurinnen und Akteure Die Akteurinnen und Akteure
Eine kleine, organisierte Minderheit Eine kleine, organisierte Minderheit Hauptträger des politischen Handelns für das Frauenstimmrecht war zwischen 1909 und 1971 der kontinuierlich aktive Schweizerische Verband für Frauenstimmrecht (SVF), wohingegen sich die Gegnerinnen in wechselnden, meist ad hoc gebildeten Bündnissen organisierten. Obschon zahlenmässig bedeutender als die gegnerischen Organisationen, handelte es sich beim SVF, auf dem im Folgenden der Fokus liegt, um einen relativ schwachen Kollektivakteur. Zur Zeit der Gründung der nationalen Organisation 1909 zählte er wie erwähnt 765 Mitglieder und sieben Sektionen, während der BSF 1904 33 Mitgliedervereine und 11 000 Frauen repräsentierte. 139 Bis 1916 gab es mehr SVF-Sektionen in der Westschweiz, dann kehrte sich das Verhältnis um. 1950 konnte der Verband 33 Sektionen ausweisen. 140 1959 hatte sich die Anzahl Mitglieder nach Jahren des Rückgangs auf 6056 und die Zahl der Sektionen auf 34 erhöht. 141 In der Zeit zwischen 1934 und 1968 oszillierte die Mitgliederzahl zwischen 4000 und 6000. 142 Der SVF war eine gemischte Organisation und zählte vor allem in den ersten zwei Jahrzehnten etliche männliche Mitglieder. Wohl um dem Vorwurf zuvorzukommen, sie seien vom Ausland gesteuert, nahm der Zentralvorstand nur Schweizerinnen auf, während auf lokaler Ebene vereinzelt auch Ausländerinnen aufgeführt sind. Die ersten Gruppen entstanden auf lokaler Ebene, meist aus einer Fusion zwischen philanthropischen und sittlichmoralischen Kreisen und dem progressiven Teil der frühen Frauenbewegung, je nach örtlichen Verhältnissen mit unterschiedlich starker Beteiligung von sozialdemokratischen und einzelnen bürgerlichliberalen, fortschrittlich eingestellten Politikern.
Männer als Feministen
Lokale Eliten
Sittlich-soziales Engagement und Erwerbstätigkeit
Von den ledigen Lehrerinnen zu den verheirateten Juristinnen
Späte Auflösung der protestantischen Dominanz und vermehrtes parteipolitisches Engagement
Konstanz und Wandel über die Zeit
Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Gegnerinnen
Die Argumente
1917 bis 1921: Gerechtigkeit, Fortschritt und wahre Demokratie versus «die Frau gehört ins Haus»
Die Zwischenkriegszeit und die Kriegsjahre: weiblicher Beitrag versus unvergleichbare Schweizer Demokratie
Die unmittelbare Nachkriegszeit: Humanisierung des Staats versus Gleichheit nur für Gleiche
Die Botschaft von 1957: zweideutiger Bundesrat
Die Debatte in den eidgenössischen Räten 1957/58: Rückständigkeit versus Schadensbegrenzung
Die Westschweizer Debatten: der ökonomische Beitrag der Frauen versus alte Gegenargumente
Nach der Abstimmung 1959: Scheindemokratie versus Mehrheitsentscheid der Männer
Die 1960er-Jahre: staatspolitische Relevanz des Frauenstimmrechts versus Status quo
Die Debatte über die EMRK 1969: störende versus relevante Frauenorganisationen
Die Debatte 1970 über die Bundesratsbotschaft: Gleichstellung mit Differenz
Der Durchbruch 1971: Dank der «Grosszügigkeit des Männervolks»
Fazit
Politische Konjunkturen und internationale Kontexte
Die Geografie der politischen Auseinandersetzungen und Abstimmungen
Der Wandel der Zustimmungsraten
Die Palette der Entscheidungsmodi
Der Wandel der politischen Kräfteverhältnisse
Die Soziologie der Akteurinnen und Akteure
Das Kaleidoskop der Argumente
Anhang
Anmerkungen
Abkürzungsverzeichnis
Bibliografie
Kartenmaterial
Szenen und Objekte
Aktionsformen und Mobilisierungsmittel im Kampf um das Frauenstimmrecht
Abbildungsverzeichnis
Rechtlicher Diskurs und Handlungsinstrumente
Veröffentlichungen der schweizerischen Staatsrechtslehre und weitere juristische Publikationen
Staatsrechtslehre und juristische Literatur von 1848 bis 1873
Staatsrechtslehre und juristische Literatur von 1874 bis 1911
Staatsrechtslehre und juristische Literatur von 1912 bis 1939
Staatsrechtslehre und juristische Literatur von 1940 bis 1959
Staatsrechtslehre und juristische Literatur von 1960 bis 1971
Argumentationslinien in der juristischen Literatur
Würdigung der juristischen Debatte
Der Beitrag des Bundesgerichts zur Debatte bis 1971
Die Stellung des Bundesgerichts
Keine Chance für das Frauenstimmrecht vor Bundesgericht
Interpretationsweg bei der Anwältinnenzulassung – historische Interpretation beim Frauenstimmrecht
Würdigung
Staatsrechtsliteratur und verfassungsrechtliche Entwicklung in den Kantonen
Die Literatur zum Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene
Erste Forderungen zur politischen Gleichstellung: Schule, Kirche und Frauenstimmrechtsvereine
Das Männerstimmvolk und kantonale Eigenheiten
Die Rolle von Regierung und Parlament
Welche politischen Handlungsmöglichkeiten sah das Bundesverfassungsrecht vor?
Anfänge in den Kantonen
Bundesebene
Politische Rechte auf völkerrechtlicher Ebene bis 1971 – und die Schweiz?
Völkerrechtliche Standards im Bereich der politischen Rechte und der Nichtdiskriminierung vor 1971
Diskurs vor 1971 über die Frage der Menschenrechtsverletzung
Anhang
Anmerkungen
Abkürzungsverzeichnis
Bibliografie
Materialienverzeichnis
Das Frauenstimmrecht – weshalb es in der Schweiz so lange dauerte und weshalb es schliesslich dazu kam
Die «natürliche» Geschlechterordnung
Geschichte – Tradition – politisches System
Die soziale Dimension
Die wirtschaftliche Dimension
Die politischen Akteurinnen und Akteure
Die institutionelle Ebene
Föderalismus
Die internationale Ebene – transnationale Verflechtungen
Politische Konjunkturen
Autorinnen
Vorwort
Als Auftraggeberin der Forschungsarbeit von Brigitte Studer und Judith Wyttenbach hat die Stiftung FRI – Schweizerisches Institut für feministische Rechtswissenschaft und Gender Law das Privileg, der Studie einige Worte zum Hintergrund ihres Auftrags vorausschicken zu dürfen.
Recht und Gesetz wirken direkt und indirekt auf die Geschlechterverhältnisse und auf die Gestaltung des Lebens von Individuen aller Geschlechter. Deshalb ist ein kritischer, geschlechterbewusster Blick auf das Recht gefragt: Diesen will das FRI einnehmen und fördert deshalb die feministische Rechtswissenschaft und Gender Law. Das Institut geht auf die Initiative von feministischen Juristinnen in den 1990er-Jahren zurück und wird aktuell von einer Gruppe von Personen getragen, die was Geschlecht, Generation, Region und beruflicher Hintergrund angeht, vielfältig zusammengesetzt ist. So ist denn auch die Vernetzung von an Geschlechterfragen im Recht interessierten Forschenden und Fachleuten aus Rechtsanwendung, Politik und Gleichstellungspraxis ein wichtiges Anliegen. Das FRI ist ein Ort des Diskurses, der sowohl auf einer rechtspraktischen wie einer theoretischen Ebene geführt wird, und wo Wert auf den Dialog zwischen den beiden Ebenen gelegt wird. Das Institut behandelt die Geschlechterfrage als Querschnittsthema, das alle Rechtsbereiche betrifft. Visionen sind eine geschlechtergerechtere Welt, die Freiheit der Lebensgestaltung ohne einengende, auf die geschlechtliche und sexuelle Identität bezogene Normen und der Abbau von Herrschaft und Hierarchien. 1
Читать дальше