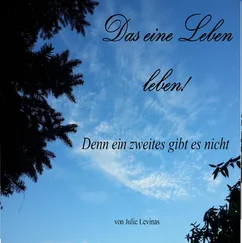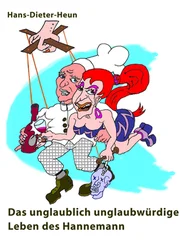Das wollen wir in diesem Buch in allgemeinverständlicher Weise versuchen. Dabei haben wir die Zusammensetzung unseres Teams mit Bedacht gewählt: Hans-Werner Wahl ist als Alternspsychologe zwar stolz auf die heute erzielten Befunde der Psychologie des späten Lebens und der Lebensspannenpsychologie, die vor allem das individuelle Altern in den Blick nimmt. Altern ist aber stets gesellschaftlich gerahmt und in Zeiten von »Diversity« wohl sogar als eine der stärksten Audrucksformen von gesellschaftlicher Vielfalt und Heterogenität zu sehen. Da hilft es sehr, eine Diversitätsforscherin, Elisabeth Wacker, als Mitautorin zu haben. Auch laufen Betrachtungen des Älterwerdens immer Gefahr, sich entweder auf die Seite von »gesunden« oder »kranken« Alternsprozessen zu schlagen, oft ohne irgendeine Brücke dazwischen zu bauen. Da ist es von großem Vorteil, Hans Förstl als Arzt im Autorenteam zu haben, der sich mit den Untiefen psychischer und körperlicher Belastungen spät im Leben seit Jahrzehnten in seiner täglichen Arbeit konfrontiert sieht. Und das alles vor dem Hintergrund einer neuen Generation von älteren Menschen, die nicht zuletzt und trotz aller Diversität eines gemeinsam haben: eine höhere Bildung und das Bedürfnis, diese im Alter zu erhalten und auszubauen. Die historisch gesehen auf das frühe Lebensalter und privilegierte Gruppen beschränkte Schulbildung hat sich heute auf breite Schichten und das ganze Leben ausgedehnt. Die Schulbank ist gerade spät im Leben noch nie so intensiv von Älteren gedrückt worden. Da ist es sehr hilfreich, wenn eine Bildungswissenschaftlerin mit gerontologischem Schwerpunkt, Ines Himmelsbach, ihre Fachkenntnisse einbringt. Zudem hat glücklicherweise kein Geringerer als der römische Konsul und Dichter Cicero unsere Einladung angenommen, jedes Kapitel mit einem Zitat aus seinem Büchlein »Cato der Ältere über das Greisenalter«, veröffentlicht im Jahre 44 v. Chr., einzuleiten. 1 1 Cicero (44 v. Chr.). Cato Maior de Senectute. Reclam Ausgabe 1965. Über das fehlende Genderbewusstsein bei Cicero sehen wir hinweg. Was er primär in Bezug auf ältere Männer schrieb, kann man heute getrost auch auf ältere Frauen verallgemeinern. Bezeichnungen wie »Greis« sind der historischen Zeit geschuldet. Wer Cicero folgen will, findet die Seitenzahl, nicht aber jedesmal das Erscheinungsdatum.
Wir bieten zudem Anregungen zum Umgang mit zentralen Fragen des heutigen Älterwerdens an.
So lädt die dritte Grundthese dieses Buches ein, gut informiert, gerne auch durch dieses Buch angeregt, über das eigene Älterwerden nachzudenken, über die großen Chancen, die sich somit ausschöpfen lassen sowie über die anspruchsvollen Anforderungen, denen man zugleich beherzt gegenübertreten kann.
Dabei geht es uns vor allem darum, Differenzierungen in die oftmals einseitig geführten Diskussionen zum Älterwerden in unserer Gesellschaft zu bringen. Bisweilen findet man nämlich meist einen Belastungsdiskurs. Danach kommt Altern die Gesellschaft teuer zu stehen, ja Altern wird sie mittel- und langfristig überfordern, wenn wir uns nicht zu signifikanten Einschnitten durchringen können. Oft gebrauchte Begrifflichkeiten in diesem Zusammenhang sind »Überalterte Gesellschaft«, »Demografiefalle«, »Rentnerschwemme« oder »Rentner-Tsunami«. Bisweilen finden wir, genauso einseitig, einen »Alles ist easy«-Diskurs zum Älterwerden. Hier sind die Begrifflichkeiten dann z. B. »Anti-Aging«, »Silver-Ager«, »Best-Ager« oder »Power-Oldies«. Beides taugt aus unserer Sicht nicht dazu, eine ausgewogene und mehrperspektivische Sicht des heutigen Alterns zu gewinnen.
Vor diesem Hintergrund lauten zentrale Fragen dieses Buches: Kann es gelingen, die vielen Stärken des Alterns auszukosten und gleichzeitig die Probleme des Alters, vor allem des hohen Alters, als unvermeidbaren Teil des »lange-Leben-Lebens« zu akzeptieren? Kann es gelingen, die Gewinne und Verluste des Älterwerdens, beide sind heute ausgeprägt, im Sinne einer überzeugenden Sinnhaftigkeit zu versöhnen? Es ist unsere Hoffnung, dass unser Buch hilft, Ihre ganz persönlichen Antworten auf diese Fragen zu finden.
1Cicero (44 v. Chr.). Cato Maior de Senectute. Reclam Ausgabe 1965. Über das fehlende Genderbewusstsein bei Cicero sehen wir hinweg. Was er primär in Bezug auf ältere Männer schrieb, kann man heute getrost auch auf ältere Frauen verallgemeinern. Bezeichnungen wie »Greis« sind der historischen Zeit geschuldet. Wer Cicero folgen will, findet die Seitenzahl, nicht aber jedesmal das Erscheinungsdatum.
1
Von Alternsfakten
1.1 Immer länger leben als Segen und Fluch
»›Wer lange lebt, sieht vieles, was er nicht begehrt.‹ Und vieles vielleicht, was er begehrt.«
(Cicero, S. 15, Cäcilius zitierend)
Schönes langes Leben!
 Die neuen Bundesländer sind dabei
Die neuen Bundesländer sind dabei
 Viel Hoffnung, aber auch Trauerflor
Viel Hoffnung, aber auch Trauerflor
Immer länger leben – Die »graue Revolution« findet demografisch längst statt
Wir werden heute so alt wie nie zuvor, vor allem wenn wir das Glück haben, in weit entwickelten Industrieländern zu wohnen. Aber auch in ärmeren Ländern wächst der Anteil älterer Menschen fast überall (Salomon et al., 2012). Im Senegal z. B. betrug die Lebenserwartung bei Geburt 1990 bei Männern 56,8 Jahre, bei Frauen 60,9 Jahre. Im Jahr 2010 waren es dann schon 63,5 (M) bzw. 67,1 (F) Jahre. In Ägypten betrug die Lebenserwartung 1990 62,4 (M) bzw. 67,0 (F) Jahre; im Jahr 2010 waren es 68,0 (M) bzw. 73,4 (F) Jahre. In Deutschland lag die Lebenserwartung in 1990 bei 71,9 (M) bzw. 78,4 (F) Jahre. Im Jahr 2010 waren es 77,5 (M) bzw. 82,8 (F) Jahre. In 2020 dürfte sie bei 79,1 (M) bzw. 84,1 (F) liegen. Das ist nach einer geschätzten mittleren Lebenserwartung bei Geburt in der Bronze- und Eisenzeit von ca. 18 Jahren, im Mittelalter von ca. 25 Jahren und in Deutschland Anfang des 20. Jahrhundert von ca. 46 Jahren eine unglaubliche Steigerung der Lebenserwartung des komplexen Systems Mensch. Eine mehr als Vervierfachung gegenüber der Zeit vor etwa 3000 Jahren, eine Verdreifachung gegenüber der Zeit vor 1000 Jahren und fast eine Verdopplung gegenüber der Zeit vor gut 100 Jahren! Ein großer Teil des mittleren Anstiegs der Lebenserwartung bei Geburt ist dem gewaltigen Rückgang der Kindersterblichkeit zu verdanken. Starben im Mittelalter etwa 30 von 100 aller Kinder vor dem 5. Lebensjahr, so sind es heute nur noch etwa 5 von 1000 Kindern. Es sei betont, dass dies durchschnittliche Werte sind. Es gab schon immer auch Menschen mit sehr vielen Lebensjahren, und hatte man erst einmal 60 Jahre erreicht, so war die Wahrscheinlichkeit, die 70 Jahre zu »nehmen«, durchaus nicht gering. Aber dies waren eben Ausnahmeerscheinungen, die heute zur Regel geworden sind. Das ist vor allem der Unterschied zu früheren Zeiten. Der bislang eindeutig verifiziert älteste Mensch, die Südfranzösin Jeanne Calment, ist übrigens 122 Jahre und 164 Tage (122,4 Jahre) alt geworden und starb im Jahr 1997.
Zoomen wir noch etwas tiefer in die demografischen Entwicklungen in Deutschland und nehmen einmal exemplarisch die Zeit zwischen 1958 und 2015 (  Abb. 1.1). Bis Ende der 1980er Jahre hatte sich hinsichtlich der verbliebenen Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren ein deutlicher West-Ost-Unterschied zugunsten der westdeutschen Männer und Frauen herausgebildet, der bei den Frauen noch stärker ausgeprägt war als bei den Männern. Nach der deutschen Vereinigung stieg allerdings die fernere Lebenserwartung 65-jähriger ostdeutscher Frauen besonders stark und schnell an, so dass heute bei den Frauen keine West-Ost-Unterschiede mehr zu beobachten sind. Bei den ostdeutschen Männern verlief der Anstieg der Lebenserwartung im Alter 65 etwas langsamer; hier haben sich seit dem Jahr 2000 die Unterschiede zuungunsten der ostdeutschen Männer nur wenig verändert, sind also auch heute noch in abgemilderter Form vorhanden. Auch bei den ostdeutschen Frauen könnte eventuell die sehr positive Entwicklung in der Lebenserwartung wieder gedämpft werden, denn nach der Wende stieg z. B. bei jüngeren Frauen das Rauchen gegenüber der vormaligen Zeit in der DDR deutlich an (Vogt et al., 2017).
Abb. 1.1). Bis Ende der 1980er Jahre hatte sich hinsichtlich der verbliebenen Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren ein deutlicher West-Ost-Unterschied zugunsten der westdeutschen Männer und Frauen herausgebildet, der bei den Frauen noch stärker ausgeprägt war als bei den Männern. Nach der deutschen Vereinigung stieg allerdings die fernere Lebenserwartung 65-jähriger ostdeutscher Frauen besonders stark und schnell an, so dass heute bei den Frauen keine West-Ost-Unterschiede mehr zu beobachten sind. Bei den ostdeutschen Männern verlief der Anstieg der Lebenserwartung im Alter 65 etwas langsamer; hier haben sich seit dem Jahr 2000 die Unterschiede zuungunsten der ostdeutschen Männer nur wenig verändert, sind also auch heute noch in abgemilderter Form vorhanden. Auch bei den ostdeutschen Frauen könnte eventuell die sehr positive Entwicklung in der Lebenserwartung wieder gedämpft werden, denn nach der Wende stieg z. B. bei jüngeren Frauen das Rauchen gegenüber der vormaligen Zeit in der DDR deutlich an (Vogt et al., 2017).
Читать дальше
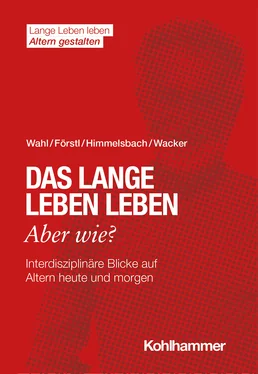
 Die neuen Bundesländer sind dabei
Die neuen Bundesländer sind dabei Abb. 1.1). Bis Ende der 1980er Jahre hatte sich hinsichtlich der verbliebenen Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren ein deutlicher West-Ost-Unterschied zugunsten der westdeutschen Männer und Frauen herausgebildet, der bei den Frauen noch stärker ausgeprägt war als bei den Männern. Nach der deutschen Vereinigung stieg allerdings die fernere Lebenserwartung 65-jähriger ostdeutscher Frauen besonders stark und schnell an, so dass heute bei den Frauen keine West-Ost-Unterschiede mehr zu beobachten sind. Bei den ostdeutschen Männern verlief der Anstieg der Lebenserwartung im Alter 65 etwas langsamer; hier haben sich seit dem Jahr 2000 die Unterschiede zuungunsten der ostdeutschen Männer nur wenig verändert, sind also auch heute noch in abgemilderter Form vorhanden. Auch bei den ostdeutschen Frauen könnte eventuell die sehr positive Entwicklung in der Lebenserwartung wieder gedämpft werden, denn nach der Wende stieg z. B. bei jüngeren Frauen das Rauchen gegenüber der vormaligen Zeit in der DDR deutlich an (Vogt et al., 2017).
Abb. 1.1). Bis Ende der 1980er Jahre hatte sich hinsichtlich der verbliebenen Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren ein deutlicher West-Ost-Unterschied zugunsten der westdeutschen Männer und Frauen herausgebildet, der bei den Frauen noch stärker ausgeprägt war als bei den Männern. Nach der deutschen Vereinigung stieg allerdings die fernere Lebenserwartung 65-jähriger ostdeutscher Frauen besonders stark und schnell an, so dass heute bei den Frauen keine West-Ost-Unterschiede mehr zu beobachten sind. Bei den ostdeutschen Männern verlief der Anstieg der Lebenserwartung im Alter 65 etwas langsamer; hier haben sich seit dem Jahr 2000 die Unterschiede zuungunsten der ostdeutschen Männer nur wenig verändert, sind also auch heute noch in abgemilderter Form vorhanden. Auch bei den ostdeutschen Frauen könnte eventuell die sehr positive Entwicklung in der Lebenserwartung wieder gedämpft werden, denn nach der Wende stieg z. B. bei jüngeren Frauen das Rauchen gegenüber der vormaligen Zeit in der DDR deutlich an (Vogt et al., 2017).