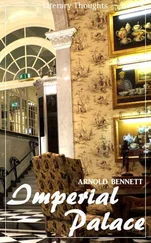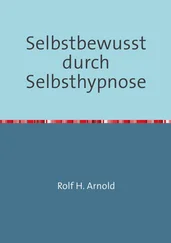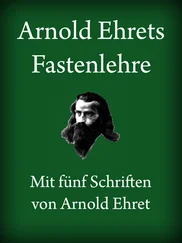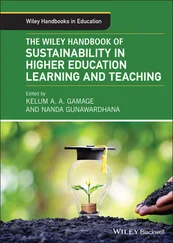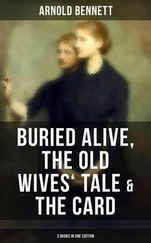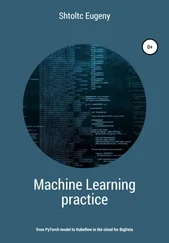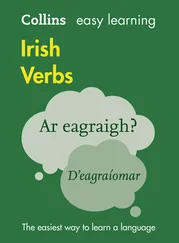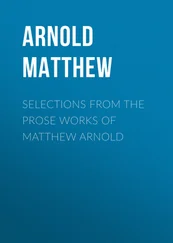Für Lehrende sollten Schnittstellen zu Autorentools implementiert sein, damit sie Lerninhalte, Arbeitsaufgaben, Übungsblätter usw. erstellen und auf der Lernplattform bereitstellen können. Je nach Aufgabengebiet der Lehrenden sind weitere Schnittstellen notwendig, z. B. zur Teilnehmerverwaltung und Zertifizierung von Lernergebnissen.
Über die Schnittstellen können die Lernenden und Lehrenden (abhängig von den rechtlichen Regelungen, siehe Kap. 11.2) Lernmaterialien auf ihren lokalen Rechner oder auf serverbasierte Anwendungen im Netz laden, dort bearbeiten und wieder auf die Lernplattform bereitstellen, z. B. um die eigenen Ergebnisse in eine Gruppenaufgabe einzufügen.
(5) Kommunikation und Kooperation
Da die Kommunikation und Kooperation für Lernprozesse eine entscheidende Rolle spielt (Kap. 2, Kap. 6) und die Lernenden in einem E-Learning-Angebot in der Regel zeit- und ortsverteilt arbeiten, muss die Lernplattform entsprechende Möglichkeiten für viele Kommunikations- und Kooperationsformen unterstützen. Dazu zählen synchrone Kommunikationsmedien wie Text-, Sprach- oder Video-Chat kombiniert mit einer Awarenessanzeige (Wer ist online?). Integrierte Videokonferenzlösungen (Kawalek 1997) vervollkommnen das Angebot synchroner Kommunikationsmedien. Durch das zeitverteilte Arbeiten bedarf es aber auch asynchroner Kommunikationsmedien wie E-Mail, Mailinglisten und Diskussionsforen (inklusive der Funktion Was ist neu?), um mit anderen Lernenden, Lehrenden oder Tutoren auch außerhalb ihrer Anwesenheit kommunizieren zu können. Die Offenheit für weitere Kommunikations- und Kooperationsmedien, die die Lernenden im Alltag einsetzen, sollte gegeben sein. Fehlen entsprechende Schnittstellen, ist die Kreativität der Tutoren gefragt. Mögliche Lösungen wären Webseiten auf der Lernplattform, die auf entsprechende Medien im virtuellen Bildungsraum verlinken. In solchen Fällen ist auf datenschutzrechtliche Aspekte (z. B. Identifizierbarkeit der Lernenden im Netz) hinzuweisen. Auf der eigenen Homepage können Lehrende und Lernende ihre Kennungen zu weiteren genutzten Kommunikationskanälen, wie bspw. Videochats, Kurznachrichtendienste oder soziale Netzwerke, auflisten, um alle Kommunikationsmöglichkeiten zu unterstützen. Solche Homepages sollten sich jedoch in einem geschützten Bereich, z. B. auf der Lernplattform, befinden, damit diese nicht von Dritten ausgelesen und missbraucht werden können. Hinzuweisen ist auch darauf, welche Informationen über externe Kommunikationskanäle fließen sollten oder können und welche besser nur in den geschützten Bereich gehören.
Auch wenn es grundsätzlich möglich ist, muss nicht jeder Lernende und Lehrende zu jeder Zeit erreichbar sein. Für eine funktionierende Kommunikation und Kooperation sollten daher schon zu Beginn verbindliche Regeln vereinbart und eingeführt werden. Die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten sind Angebote, aber keine verpflichtende Aufforderung zum Austausch.
Durch die Ausprägung der sozialen Komponente in Online-Gemeinschaften gewinnen auch die Rollenfunktionen aller Beteiligten eine stärkere Bedeutung (Kerres u. a. 2009). An die Rollen sind Erwartungen bzgl. des Verhaltens und Handelns geknüpft. Diese sind im Internet zugleich mit Rechten verbunden (der Administrator darf bspw. am System arbeiten, der Gast darf nur eingeschränkt in einen Kurs schauen, ohne etwas zu verändern). Je mehr Rollen eine Lernplattform anbietet, desto mehr Rollen können auch im Lehr- und Lernprozess vergeben werden. „Insofern ist die Zuweisung von Rollen zu Personen in einem LMS eine ganz zentrale und vielleicht nicht immer hinreichend reflektierte Funktion“ (ebd., 115). Neben den üblichen Rollen der Lehrenden und Lernenden kann es, um nur einige zu nennen, u. a. auch die von Tutoren (Organisation im Lernprozess, inhaltliche Betreuung), Administratoren (Technik) oder Verwaltung (Koordination formaler Abläufe) geben, die für verschiedene Aufgabenfelder tätig sind. Auch für Gruppenarbeiten auf der Lernplattform sind solche Rollen von Bedeutung. Neben den Gruppenmitgliedern, die gemeinsam eine Aufgabe bearbeiten, können weitere Rollen wie z. B. die eines Zuschauers (mit Rechten wie z. B. Betrachten, Feedback geben, aber nicht bearbeiten) oder Gruppenleiters (mit Rechten wie z. B. Abstimmungen vorbereiten, Aufgaben verteilen, Lernprozesse abschließen) vergeben werden. Weiterhin sind Rollen von Experten, Beratern, Prüfern u. a. m. denkbar. Je mehr Rollen verfügbar sind, desto differenzierter können die Lehr-Lern-Szenarien gestaltet werden. Die Rollenfunktion spielt auch für den Bereich der Erstellung und Präsentation von Lernergebnissen, z. B. in einem E-Portfolio-System, eine tragende Funktion. Hier sollten die Lernenden selbst entscheiden können, wer wann welche Inhalte sehen, kommentieren oder gar verändern kann. Befinden sich Lernergebnisse in einem Entwurfsstatus, sollten vielleicht nur die Erstellenden selbst sowie Personen der Arbeitsgruppe Einblick haben. Eine finale Version eines Lernergebnisses hingegen kann den Prüfern vorgelegt oder auch als Bestandteil einer digitalen Bewerbungsmappe Personalverantwortlichen in Unternehmen außerhalb des virtuellen Bildungsraums freigeschaltet werden.
Software zum gemeinsamen Bearbeiten von Inhalten (Content Sharing), wie z. B. ein Whiteboard, sind für kooperative Lernprozesse wichtig. Außerdem gewinnen die Web-2.0-Anwendungen zunehmend an Bedeutung (Gaiser 2002, 2008). Wikis, Social Bookmarks, Social E-Books etc. ermöglichen es den Lernenden, gemeinsam innerhalb der Lernplattform an Lerngegenständen zu arbeiten und sich auszutauschen. Eine Anbindung an die anderen Funktionsbereiche ist notwendig, um auf die für die Kommunikation und Kooperation relevanten Funktionen zugreifen zu können. So dient z. B. die Kalenderfunktion zur Abstimmung von synchronen, virtuellen Gruppentreffen (Bereich Angebot und Auskunft), in denen dann an einem Lernprodukt gearbeitet wird (Bereich Mediathek und Ergebnisse), wozu eventuell bestimmte Anwendungen genutzt werden (Bereich Schnittstellen und Anwendungssoftware), um diese dann als Lernergebnis bewerten zu lassen (Bereich Prüfung und Evaluation).
Für die Lehrenden stehen dieselben Funktionen zur Verfügung. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, Mandate zur Nutzung einzelner Kommunikationsmittel zu vergeben. Synchrone Kommunikationsmittel sollten eine Protokoll- und Archivierungsfunktion beinhalten, damit es für die Nutzer möglich ist, Chats nachzulesen, um beispielsweise einen Lösungsweg nachvollziehen zu können. Protokolle bzw. Diskussionsmitschnitte stellen eine Dokumentation der Lernprozesse sowie eine zusätzliche Arbeitsressource dar.
Da in virtuellen Bildungsräumen die Kommunikation und Kooperation dadurch erschwert wird, dass soziale und nonverbale Hinweisreize (Mimik, Gestik usw.) sowie gemeinsames Hintergrundwissen teilweise reduziert sind oder fehlen, können spezielle Werkzeuge eingesetzt werden, um diese Defizite auszugleichen. Solche sind z. B. Lernnetze (grafische Repräsentationen des gemeinsamen Wissenshintergrundes), Lernprotokolle (schrittweise Anleitungen für gemeinsame Arbeitsprozesse) und Tools zur Gruppenwahrnehmung (Arnold 2001, 38).
(6) Prüfung und Evaluation
Dieser Bereich innerhalb eines virtuellen Bildungsraums bietet den Lernenden die Möglichkeit, ihre Lernleistungen und Lernerfolge zu überprüfen und anderen eine Rückmeldung über ihre Lernerfahrungen, z. B. eine Bewertung der Lernunterstützung, zu geben. Da hier lernersensible Daten ausgetauscht werden, ist es wichtig, dass dieser Bereich nur von autorisierten Nutzern mit Passwort betreten werden kann und die jeweiligen Daten nur von autorisierten Personen im virtuellen Bildungsraum einsehbar sind. Auch hier haben Lernplattformen ihre Vorteile, da sie entsprechenden Schutz gewähren.
Lernplattformen sollten es den Lehrenden ermöglichen, ohne großen Aufwand Tests zu erstellen (z. B. Multiple-Choice-Tests, Drag-and-Drop-Aufgaben), die den Lernenden zur Selbstüberprüfung dienen, aber auch in die Gesamtbewertung eines Lernmoduls eingehen können. Jedoch sind gerade in einem virtuellen Lernangebot automatisch auswertbare Aufgaben keineswegs ausreichend. Entscheidend für die Kompetenzentwicklung sind vielmehr umfassende und komplexe Lernaufgaben für Einzelne und Lerngruppen, die von den Lehrenden oder anderen Experten mit kompetenzorientierten Tests und Prüfungen oder von den Tutoren, aber auch von der Gemeinschaft der Lernenden selbst bewertet werden (Wildt 2011, 13 ff.; Kap. 7). Aber auch digitale Lernverlaufsprotokolle oder E-Portfolios eignen sich hierfür (Kilian 2015, S. 54 f.; Bergestermann u. a. 2013, S. 26).
Читать дальше