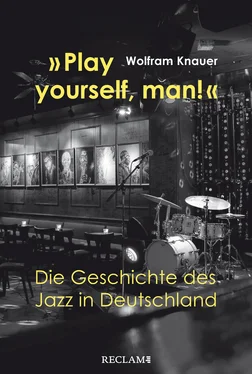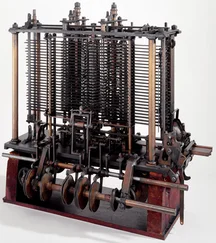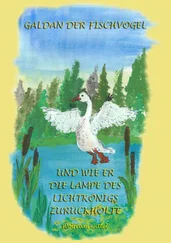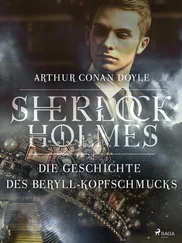Lutz Templin Orchester, um 1942
Das Konzept des Orchesters war simpel: Es spielte aktuelle amerikanische Titel in Swing-Arrangements, in denen allerdings spätestens im zweiten Vokalchorus der originale Text gegen einen Propagandatext in englischer Sprache ausgetauscht wurde, der sich gegen die Kriegsgegner oder gegen eine vermeintliche jüdische Aggression richtete. Adressaten der Musik waren keinesfalls die deutsche Bevölkerung – tatsächlich standen die Platten nie zum Verkauf –, sondern die Radiohörer im feindlichen Ausland, speziell in Großbritannien, die der deutsche Auslandsrundfunk über Kurzwelle erreichen wollte. Ziel war die Demotivation der Zivilbevölkerung und potentiellen Soldaten. Von den Platten wurden jeweils nur 50 bis 100 Exemplare gepresst, die dann zur Ausstrahlung durch Auslandssender oder in Kriegsgefangenenlagern bestimmt waren. Zwischen Herbst 1940 und September 1943 nahm das Orchester weit über 100 Titel auf. Als die Bombardierung Berlins zunahm, wurden die Musiker nach Stuttgart evakuiert, wo sie zwar weiter in Livesendungen zu hören waren, aber mangels Equipments keine professionellen Platteneinspielungen mehr machten.164
Lange Zeit war Charlie and his Orchestra eine Art Legende gewesen. Der Schellacksammler und Jazzexperte Rainer E. Lotz brachte 1975 zwei LPs mit Aufnahmen des Orchesters heraus, denen die kompletten Texte der Stücke beilagen, musste die Veröffentlichungen dann aber zurückziehen, als ein deutscher Musikverlag mit juristischen Schritten drohte, »weil die nicht autorisierten anti-amerikanischen und anti-semitischen Verballhornungen [der ursprünglichen amerikanischen Kompositionen] den Interessen des amerikanischen Mutterhauses zuwiderliefen«.165 Zehn Jahre später übernahm ein britisches Label die Aufnahmen, die jetzt auf größeres historisches Interesse trafen und 1988 unter anderem in einem weit beachteten Artikel im Spiegel resultierten.
Die Sängerin Evelyn Künneke kannte viele der Mitglieder von Charlie and his Orchestra gut und beschrieb eine Besetzung, die »hauptsächlich aus italienischen, belgischen und tschechischen Musikern bestand; es gab ein paar Halbjuden und Zigeuner, Freimaurer, Jehovas Zeugen, Homosexuelle und Kommunisten – nicht gerade die Art von Menschen, mit denen die Nazis sonst Karten spielen würden. Aber weil ihre Arbeit als kriegswichtig angesehen wurde, saßen sie hinter den Notenständern in Berlin und nicht hinter Stacheldraht, und machten Swing.«166 Zu den Musikern also gehörten neben deutschen Jazzern Kollegen aus den erwähnten Nationen, darüber hinaus aber auch aus Schweden und sogar Kuba (via Spanien). Templin wurde eine Genehmigung erteilt, offiziell Auslandssender abzuhören, um von ihnen die neuesten Stücke und Arrangements mitzuschneiden und diese dann selbst oder mit Hilfe einiger seiner Musiker zu transkribieren.
Das Repertoire der Band bestand größtenteils aus den amerikanischen Schlagern der Zeit, Stücken wie »Bei mir bist du schön«, »The Sheik of Araby«, »Bye Bye Blackbird« oder »Dinah«. In der Umsetzung der Arrangements standen dabei neben den amerikanischen Originalen auch die Interpretationen britischer Tanzorchester Pate, die etwas weniger vom Blues beeinflusst waren und dafür etwas stärker die Schlager der Music-Hall im Blick hatten. Anfangs köderte man das Publikum durch die swinggerechte Interpretation einschließlich Originaltext, dann folgte, meist nach einer förmlichen Ansage, der Propagandatext, eher in deutlicher Sprech- als Singstimme intoniert. In einigen der Titel wurde das Orchester um Streicher erweitert. Es gibt vereinzelte, wenn auch meist nur kurze, selten mehr als acht Takte lange Solopassagen; am jazzigsten ist in vielen der Titel die Klavierbegleitung zu den Propagandatexten, die stellenweise wie ein davon völlig unabhängiges swingendes Pianosolo klingt (so beispielsweise der Pianist Franz Mück in »Nice People« vom Herbst 1940). Später wurde immer öfter auf die Originaltexte verzichtet, was zum einen der Tatsache zu verdanken sein mag, dass irgendwann ein etwas geübterer Muttersprachler die Texte verfasste, die durchaus Sprachwitz aufweisen konnten (etwa »The Man With the Big Cigar« vom Januar 1942 oder Cole Porters »You’re the Top« vom August 1942), und was zum zweiten dazu führte, dass die Textierung der dreieinhalb Minuten nur noch etwa die Hälfte der Aufnahmen ausmachte, die Musik drumherum also interessanter gestaltet werden konnte.
Textlich sind die Aufnahmen reine Kriegspropaganda; und es verstört vielleicht am meisten, dass man noch heute beim Anhören zu verstehen meint, wie direkt und unmittelbar Musik Stimmung machen kann. Am harmlosesten wirken da noch die Texte, die einfach nur die Stärke Deutschlands beschwören, gegen das Krieg zu führen einfach keinen Sinn mache, »Tea for Two« etwa aus dem Sommer 1941, das sich auch dadurch auszeichnet, dass es mit dem Thema des »St. Louis Blues« beginnt und der Klarinettist (wahrscheinlich Benny de Weille) im zweiten Teil dieses Parts Klarinettenläufe und -glissandi spielt, die klingen, als habe er viel Barney Bigard gehört. Nach dem Propagandapart steht fast die ganze zweite Hälfte der Aufnahme für einen arrangierten Orchesterchorus zur Verfügung, einschließlich eines weiteren relaxten achttaktigen Klarinettensolos, das bis in den Schlussteil hineinreicht.
Ende 1940 spielte das Orchester aber auch den originalen »St. Louis Blues« ein, von Anfang an als Parodie, und damit zumindest indirekt an ein Beispiel aus den USA anknüpfend: Schon Glenn Miller hatte W. C. Handys Komposition 1939 in einem Arrangement von Jerry Gray im strammen Marschrhythmus interpretiert. Die Fassung von Charlie and his Orchestra beginnt eher wie eine Art Stomp, dann heißt es: »A Negro from the London docks sings the black-out blues«. Der Text der Parodie bezieht sich jetzt nur noch auf den Kriegskontext, auf die Tatsache nämlich, dass Deutschland gerade 65 Nächte hintereinander Bomben auf London geworfen habe. Nach dem Textteil ist noch ein Klarinettensolo zu hören, für das ebenfalls wahrscheinlich Benny de Weille zuständig war.
In »You’re Driving Me Crazy« vom Herbst 1940 wettert Schwedler »als Winston Churchill« gegen die Juden, auf die kein Verlass sei, und verdammt den Dreimächtepakt zwischen Deutschland, Italien und Japan, der den Briten nur Sorge und gewiss nicht den Sieg bringen würde. Irving Berlins »Slumming on Park Avenue« wird 1940 zu »Let’s Go Bombing«, und »Goody Goody« vom Sommer 1941 zu einer Anti-Churchill-Parodie. »Makin’ Whoopee« vom Februar 1942 beginnt mit den Zeilen: »Another war, another profit, another Jewish Business trick! Another season, another reason, for makin’ whoopee!« Und in »You’re the Top« vom August 1942 dichtet der unbekannte Texter Cole Porters sprachwitzige Zeilen in eine Art furchterregendes Nazi-Poem um. Wo Porter die angebetete Liebste mit schönen, wenn auch absurden Kunstwerken und Alltagsgegenständen vergleicht, heißt es jetzt: »You’re the top – you’re a German flyer. You’re the top – you’re machine-gun fire. You’re a U-Boat chap with a lot of pep. You’re grand. You’re a German Blitz, the Paris Ritz, an army van. You’re the Nile, an attack by Rommel. You’re the mile that I’d walk for a Camel. I’m a Soviet check, a total wreck – a fluff! But it’s baby: I’m the bottom you’re the top!« Ja, es mag wie eine Art makabrer Humor wirken, Luftangriffe (»German raid«, »Stuka noise«), die Stimme des deutschen Oberbefehlshabers (»Göring’s voice«) und die Stärke der Nazis (»Nazi might«) als Komplimente an die Liebste zu verstehen, im Propagandaministerium aber war man sich sicher, dass solche Texte, die Lässigkeit, mit der der Sänger die deutsche Überlegenheit suggerieren wollte, genauso wie der schmissige Bigband-Sound einschließlich hinreißender Soli und swingender Riffs ihre demotivierende Wirkung der feindlichen Bevölkerung und Truppen nicht verfehlen würde. Was diese Aufnahmen aber wirklich bewirkten bei denen, für die sie bestimmt waren, lässt sich schwer sagen.
Читать дальше