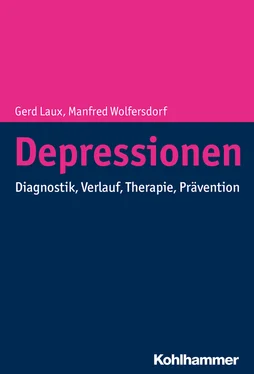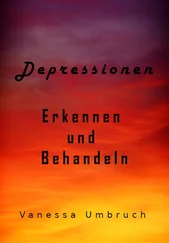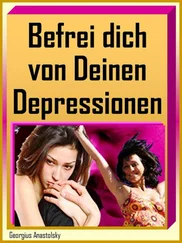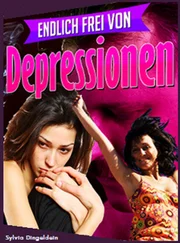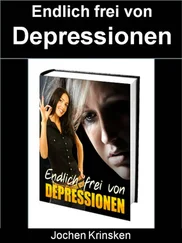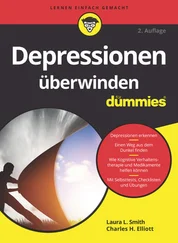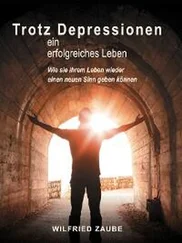Wolfram Schmitt eröffnet seinen Beitrag »Zur Phänomenologie und Theorie der Melancholie« in »Melancholie in Literatur und Kunst« (1990, S. 14–28) mit dem Satz, den er als »Enttäuschung« bezeichnet: »Was Melancholie ist, wissen auch die Psychiater nicht. Es gibt jedoch unter der Mehrzahl der Psychiater einen ungefähren Konsens darüber, was als das Erscheinungsbild der Melancholie zu gelten habe. Es handelt sich hierbei um einen psychopathologischen Symptomenkomplex, ein Syndrom, besser um ein Kern- oder Achsensyndrom oder auch um einen Idealtypus, den man als Melancholie oder zyklothyme Depression bzw. endogene Depression anzusprechen pflegt. Dieser Typus Abnormität, den man auch zu den affektiven Psychosen rechnet, ist auf der phänomenologisch-beschreibenden Ebene durch folgende Erscheinungen gekennzeichnet, die keineswegs vollständig ausgeprägt sein müssen: 1) Verstimmung, 2) Vitalstörungen und 3) Hemmung, 4) Wahn, 5) Suizidalität, 6) körperliche Verstörungen, insbesondere Biorhythmusstörungen« (S. 14).
Jaspers (1913) sah in der »tiefen Traurigkeit« und der Hemmung allen seelischen Geschehens den Kern der Depression. Kurt Schneider (1920) sprach von der »vitalen Traurigkeit«, Schulte (1961) von »Nicht-Traurig-Sein-Können«, Heinrich (1966) von »Herabgestimmtheit«, womit der Versuch gemacht werden sollte, die vom Patienten meist selbst schwer in Worte zu fassende, schwer auch nachvollziehbare depressive Herabgestimmtheit in Stimmung und Gefühlen, die sich deutlich von Trauer und Traurigkeit absetzen lässt, zu benennen (Kohs und Tölle 1987).
Wirft man einen ganz kurzen Blick auf die psychoanalytisch-tiefenpsychologische Literatur, so stößt man als erstes auf die klassische Schrift von Freud »Trauer und Melancholie« (1917): »Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal etc. Unter den nämlichen Entwicklungen zeigt sich bei manchen Personen, die wir darum unter den Verdacht einer krankhaften Disposition setzen, anstelle der Trauer eine Melancholie. […] Die Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tiefe schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt und den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühles, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert und bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe steigert.« Freud (Freud 1917 GWX 428–446) verweist auf die außerordentliche Herabsetzung des Ich-Gefühles, eine »großartige Ichverarmung«, die Störung des Selbstgefühles, und meint, dass bei der Trauer die Welt arm und leer geworden sei, bei der Melancholie sei es »das Ich selbst«. Daniel Hell (2012) schreibt, es scheine ihm angebracht, die heutige Depressionsdefinition der Weltgesundheitsorganisation in der ICD-10 als diagnostische Übereinkunft zu übernehmen, dabei aber offen zu bleiben »für die Vielfalt depressiver Bilder und die Mehrdimensionalität depressiven Leidens« (S. 13). Zudem entwickelt er die grundlegende Vorstellung von der Depression als einer »Gleichgewichtsstörung« und verweist auf Gemeinsamkeiten aller Depressionstheorien und historischen Konzeptionen von Melancholie, Akedia und »dunkler Nacht«, welche »regelhaft von einem Ungleichgewicht ausgehen, sei es von einem Ungleichgewicht körperlicher Stoffe, seelischer Kräfte oder sozialer Verhältnisse.« (S. 15). Ihm erscheint das depressive Geschehen als eine spezifische Störung des Gleichgewichts, ohne dass allerdings schon klar sei, welche Hierarchieebenen in welcher Weise aus dem Gleichgewicht gebracht seien und wie sich die verschiedenen Ebenen gegenseitig beeinflussen würden. Marianne Leuzinger-Bohleber (2005 S. 21 ff.) erinnert daran, dass viele der älteren Arbeiten aus der Tiefenpsychologie und Psychoanalyse Depression im Zusammenhang mit einem Verlust eines realen oder inneren Objekts gesehen haben. Bleichmar (2003) schlug vor dem Hintergrund zahlreicher psychoanalytischer Arbeiten vor, Depression nicht als einen krankhaften Zustand zu betrachten, sondern die Depression als einen Prozess zu verstehen, der abhängig von internalen und externalen Bedingungen ablaufe. Böker und Northoff (2016, S. 15) verstehen Depression als »Psychosomatose der Emotionsregulation« und fassen als wesentliche psychodynamische Merkmale der Depression die Reaktivierung früherer kindlicher Verlusterfahrungen, die Introjektion des verlorenen Objektes in Verbindung mit negativen Affekten und den Verlust aktueller Objektbeziehungen auf.
Griesinger (1845, S. 165–166) war der Meinung, das Zentrale der Melancholie sei »ein psychisch schmerzhafter Zustand. […] Und dieses psychische Wehthun besteht für die Kranken selbst in einem Gefühl von tiefem geistigen Unwohlsein, von Unfähigkeit zu Handeln, von Unterdrückung aller Kraft, von Niedergeschlagenheit und Traurigkeit, in einer totalen Herabgestimmtheit des Selbstgefühls«. Karl Jaspers (1973, S. 90) sprach davon, dass es sich bei der Depression »nicht um Apathie, sondern um ein qualvolles Fühlen eines Nichtfühlens« handle. Die Kranken würden unter dieser subjektiv empfundenen Gefühlsleere ungeheuer leiden. Abschließend schreibt der amerikanische Psychoanlytiker Sidney Blatt (2002, S. 29): »Thus, depression can be defined as a basic affect state that can range from a relatively appropriate and transient dysphoric response to untoward life events to a severe and persisting disorder that can involve serious distortions of reality«.
Fasst man zusammen, so sind Absicht und Versuch, depressive Erkrankungen zu operationalisieren und auf einer eher Symptom- und Verhaltensebene zu beschreiben, gut nachvollziehbar. Wie später noch weiter ausgeführt wird, bieten sich Syndrombeschreibungen wie »depressive Episode« in der ICD-10 – oder früher »depressives Syndrom« – für derartige Vereinheitlichungen an, bergen aber auch immer die Gefahr der Überforderung und der Ausfransung in den Grenzbereichen. Trotzdem ist festzuhalten, dass über Jahrhunderte hinweg im Zentrum des Verständnisses von Melancholie, später der Depression, die Störung der Affektivität gesehen wird, ob nun als Trauer, als Herabgestimmtheit, als Gefühlsleere, als reduziertes Gemüt, als Schwermut oder auch als psychischer Schmerz bezeichnet, und anderseits die Betrachtung der Welt mit den Augen eines Melancholikers; wobei sich hier der Übergang zur melancholischen Weltsicht, ohne Krankheitswert, anbietet. Die somatische Betroffenheit in der Depression mit all ihren psychosomatischen Beschwerden, von den Schlaf- und Appetitstörungen bis hin zu den sexuellen Störungen, insgesamt zu einem veränderten körperlichen Erleben, kommen im engeren Sinne erst in der psychiatrischen Literatur der letzten beiden Jahrhunderte in den Fokus der Betrachtung. Interessant ist dabei, dass von psychiatrisch-soziologischer Seite (siehe Hell 2012) eine Störung des Gleichgewichtes als zentrales Erleben der Depression postuliert wird, von psychoanalytisch-tiefenpsychologischer Seite der Verlust realer Objektbeziehungen und nicht mehr nur unbewusste und triebpsychologische Aspekte gesehen werden (z. B. Böker und Northoff 2016).
Warum ist Psychiatrie-Geschichte, hier am Beispiel von der Melancholie/Depression hilfreich? Psychiatrie-Geschichte ist ganz früh eine Geschichte des Wahnsinns, dann im Mittelalter eine des Körpers (Vier-Säfte-Lehre) verknüpft mit religiösen Themen (Sünde), dann eine Krankheits- und Krankengeschichte in den letzten drei Jahrhunderten. Die Melancholie war immer besonders: beim »Raptus melancholicus« wird der Suizident auch im Mittelalter exkulpiert und christlich beerdigt; Melancholie und Genie werden gemeinsam gesehen; uni- und bipolare Erkrankungen klar psychopathologisch beschrieben. So groß sind die Unterschiede zum heutigen Bild nicht!
Читать дальше