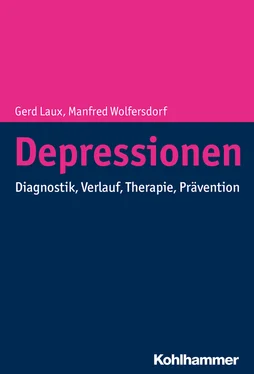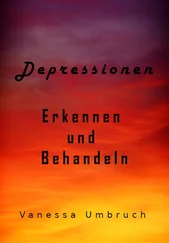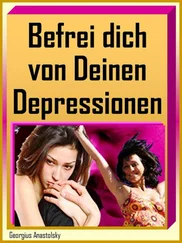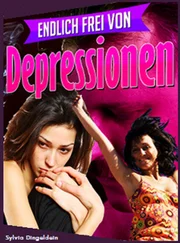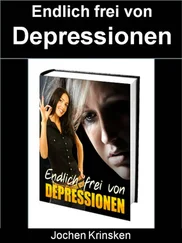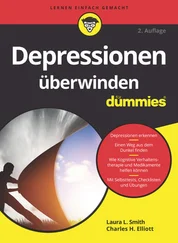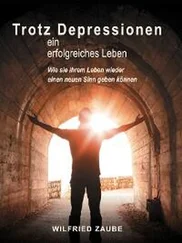Manfred Wolfersdorf - Depressionen
Здесь есть возможность читать онлайн «Manfred Wolfersdorf - Depressionen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Depressionen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Depressionen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Depressionen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Depressionen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Depressionen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Viele Beiträge zur Psychiatriegeschichte beginnen mit dem klassischen Satz, welcher der Schule von Hippokrates von Kos (ca. 460 bis 370 vor Christus) (Mora 1990) zugeschrieben wird: »Man sollte wissen, dass nur im Gehirn, sonst nirgendwo, Freude, Entzücken, Lachen und Spielen entsteht ebenso Trauer, Sorge, Verzagtheit und Klage. Ebenso werden durch das Gehirn auf bestimmte Weise Vorstellungen und Wissen gestaltet, mit seiner Hilfe hören und sehen wir. Durch das gleiche Organ werden wir wahnsinnig und verwirrt, Ängste und Schrecken treten an uns heran, am Tag oder bei Nacht […] und all dies wiederfährt uns durch unser Gehirn, wenn es nicht gesund ist« (Mora 1990).
Bei Hellmut Flashar findet sich eine Zusammenfassung der medizinischen Theorien zur Melancholie und Melancholikern in der Antike.
Hippokrates: »Wenn Furcht und Mißmut lange anhalten, so ist das melancholisch«.
In der Abhandlung »Problemata« von Aristoteles (wahrscheinlich von Theophrast) findet sich eine der ersten Betrachtungen zur Melancholie. Er sieht das »Zuviel an schwarzer Galle« positiv und spekuliert, warum »alle außergewöhnlichen Männer Melancholiker« seien.
Frühchristlich wird krankhafte Traurigkeit als Erscheinung der Acedia, der »Sünde der Trägheit« verstanden. Luther zitiert den damals weit verbreiteten Satz »Caput melancholicum est balneum diabolicum« – der melancholische Kopf ist ein Bad des Teufels, die Kranken wurden zu Sündern.
Der englische Lyriker Samuel Taylor Coleridge stellte im 18. Jahrhundert fest, dass man in der Natur keine Melancholie finde.
Als Bild einer Künstler-Melancholie gilt das berühmte Bild »Melencolia I« von Albrecht Dürer 1514, im Sinne einer Allegorie von Melancholie bzw. Depression. Die dargestellte Figur blickt ins Unbestimmte, ihr Buch ist zugeklappt, Werkzeug liegt unbeachtet auf dem Boden.
1818 benutzte Heinroth, Lehrstuhlinhaber für Seelenheilkunde in Leipzig, als einer der ersten den Begriff »Depression« in Deutschland. Er schrieb »ein böser Geist wohnt in den Seelengestörten, sie sind die wahrhaft besessenen«.
Aretaios von Kappadokien (ca. 80 bis um 130 nach Christus) gilt als Erstbeschreiber des Alternierens der Gestimmtheit bei heute sog. bipolaren affektiven Erkrankungen: »Es scheint mir aber die Melancholie Anfang und Teil der Manie zu sein« (Arenz 2003, S. 34). Grundlage seiner Überlegungen war immer die Vier-Säfte-Lehre von Hippokrates und später Galen, die sich durch das gesamte Mittelalter zog: Blut (Sanguiniker), gelbe Galle (Choleriker), schwarze Galle (Melancholiker), Schleim (Phlegmatiker), entsprechend den vier Elementen Feuer, Luft, Erde, Wasser sowie den vier Himmelsrichtungen und den Qualitäten heiß, kalt, trocken und feucht.
Die Äbtissin und Mystikerin Hildegard von Bingen (1098 bis 1179) schrieb in ihrem Buch »Causae et curae« wohl als Erste über Geschlechtsunterschiede in der Depression bei melancholischen Männern und Frauen. Melancholische Männer hätten »eine düstere Gesichtsfarbe, auch sind ihre Augen ziemlich feurig und denen der Vipern ähnlich. Sie haben harte und starke Gefäße, die schwarzes und dickes Blut in sich enthalten, […] und hartes Fleisch und grobe Knochen, die nur wenig Mark enthalten.« Allerdings werden depressive Frauen als noch beklagenswerter geschildert: »Sie haben mageres Fleisch, dicke Gefäße und mäßig starke Knochen. Ihr Blut ist mehr schleimig wie blutig, ihre Gesichtsfarbe ist wie mit einem blaugrauen und schwarzen Ton gemischt. Solche Frauen sind windig und unstet in ihren Gedanken, auch übler Laune, wenn sie durch eine Beschwerde dahinsiechen. Sie haben ein wenig widerstandsfähiges Naturell und leiden deswegen manchmal an Schwermut. […] Auch das Kopfleiden, das von der Schwarzgalle verursacht wird, werden sie bekommen wie auch Rücken- und Nierenschmerzen.« Bzgl. der Entstehung der »schwarzen Galle« im menschlichen Körper weist sie eindeutig dem biblischen Sündenfall Adams Schuld zu: »Als Adam das Gebot übertreten hatte, wurde der Glanz der Unschuld in ihm verdunkelt, seine Augen, die vorher das Himmlische sahen, wurden ausgelöscht, die Galle in Bitterkalt verkehrt, die Schwarzgalle in die Finsternis der Gottlosigkeit und er selbst völlig in eine andere Art umgewandelt. Da befiehl Traurigkeit seine Seele und diese suchte bald nach einer Entschuldigung dafür im Zorn. Denn aus der Traurigkeit wird der Zorn geboren, woher auch die Menschen von ihrem Stammvater her die Traurigkeit, den Zorn und was ihnen sonst noch Schaden bringt, übernommen haben (zit. nach Liebig 1992, S. 11–18)«. Die Vier-Säfte-Lehre in einen mittelalterlichen christlichen Kontext gestellt. Allerdings, übersetzt in das heutige Verständnis und die heutige Sprache, beschreibt Hildegard von Bingen hier die »Männerdepression«, wie wir sie von depressiven Männern kennen, die Reizbarkeit, den Zorn, die Selbstschädigung z. B. im Abwehrversuch von Depressivität durch extremen Sport, durch übermäßige Arbeit, durch eigentherapeutischen schädlichen Gebrauch von Alkohol, Medikamenten oder Drogen. Denn die »depressive Episode«, wie sie die ICD-10 beschreibt, ist ja eine »weibliche« Depression.
Das Buch von Robert Burton (1. Auflage Oxford 1621) »Anatomie der Melancholie. Über die Allgegenwart der Schwermut, ihre Ursachen und Symptome sowie die Kunst, es mit ihr auszuhalten« gilt als der Klassiker der Melancholie-Literatur. Man muss es gelesen haben und begreift dann den Unterschied zwischen Melancholie als Krankheit des Individuums und als Gestimmtheit und Temperamentslage der Gesellschaft. Eingangs steht ein Gedicht des Autors zur »Melancholie«, wobei er Melancholie einmal als süßeste Lust, dann als schmerzvollste Last, als sauerste Last, dann wieder als süßeste Lust, als verdammte Last, als bitterste Last, als drückendste Last und als verfluchte Last bezeichnet und die letzten Zeilen lauten: »Mein Los, das tausch ich auf gut Glück mit jedem Mistkerl, Galgenstrick, wie Höllenfeuer brennt die Qual, ich muss heraus, hab’ keine Wahl, und das Leben ist mir hassenswert, wer leiht ein Messer, wer hält das Schwert? Anders Leid – Gold gegen die verfluchte Last: Melancholie«. Zwei Hauptthemen ziehen sich durch das vor allem in der ersten Hälfte sehr locker und lebendig erzählende Buch, nämlich die Melancholie als eine Weltsicht, und er zitiert den Prediger Salomo, dass die Menschen überlaunig, schwermütig, verrückt, wirrköpfig sind, der schreibt: »Da wandte ich mich zu sehen die Weisheit und die Tollheit und Torheit« und weiter: »Denn all seine Lebtage hat er Schmerzen mit Grämen und Leid, dass auch sein Herz des Nachts nicht ruht. So kann man unter Melancholie vieles verstehen und sie begreifen als Schwermut im eigentlichen oder uneigentlichen Sinn, als Anlage oder Gewohnheit, als Auslöser von Schmerz- oder Lustempfindungen, als Schwachsinn, Missmut, Furcht, Kummer, Verrücktheit, sie das alles oder nur einen Teil davon umfassen lassen, buchstäblich oder metaphorisch von ihr reden – es ist jeweils Aspekt derselben Sache.« Im zweiten Teil, dem sog. »Hauptteil« setzt Robert Burton sich dann mit der Melancholie als Erkrankung auseinander. Dabei schreibt er: »Melancholie, der Gegenstand dieser Untersuchung, tritt entweder als Stimmung oder als Naturell auf. Als Stimmung bezeichnet sie jene vorübergehende Niedergeschlagenheit, die noch die unbedeutendsten Anlässe von Kummer, Mangel, Krankheit, Ärger, Furcht, Trauer, geistiger Unruhe, Missmut und Sorge begleitet. Sie kommt und geht, löst Bedrücktheit, Stumpfheit, Verdruss aus, macht das Herz schwer, ist folglich dem Vergnügen, Frohsinn, der Freude und dem Genuss in jeder Weise entgegengesetzt und erzeugt in uns Widerspenstigkeit und Abneigung. […] Und von diesen melancholischen Anwandlungen ist keine lebende Seele frei.« (Burton 1651, dtsch. Übers. Hartmann 1988, S. 41 ff und S. 309 ff). Wenige Zeilen später schreibt Burton dann »aber weil so wenige diesen guten Rat annehmen oder ihn richtig in die Tat umsetzen, weil sie vielmehr wie die wilden Tiere den Leidenschaften ihren Lauf lassen, sich ihnen unterwerfen und so in ein auswegloses Labyrinth von Sorgen, Kümmernissen und Nöten geraten, also ihre Seele ausliefern und sich nicht in der Geduld üben, die ihnen anstünde, deshalb geschieht es sehr häufig, dass die Anwandlungen und Stimmungen sich zu habitueller Schwermut verfestigen. Eine vorübergehende Erkältung löst […] nur Husten aus; wird sie aber chronisch, dann ist Schwindsucht die Folge. Ähnlich verhält es sich auch mit den melancholischen Reizen und je nachdem, ob die schwarze Galle auf einen empfänglichen oder einen widerstandsfähigen Organismus stößt, kommt es nur zu geringfügigen oder durchschlagenden Wirkungen […] Vielmehr gibt er bei dem geringsten Anlass, sei es eine eingebildete Kränkung, Kummer, Schande, seien es Verluste, Gaunereien, Gerüchte, seinen Gefühlen nachkommen, dass sich sein Aussehen verändert, seine Verdauung gestört wird, keinen Schlaf mehr findet, seine Lebensgeister schwinden, das Herz schwer und der Leib hart wird. Er laboriert an Blähungen und verdorbenem Magen, und Melancholie überwältigt ihn. […] Im Handumdrehen und wie durch eine geöffnete Tür überfallen ihn alle möglichen anderen quälenden Gedanken, und wie ein hinkender Hund oder flügellahme Gans siecht er dahin und fällt schließlich der habituellen Schwermut und krankhaften Melancholie zum Opfer.« Später definiert er »Melancholie« als »eine Art fieberfreier Verrücktheit, die normalerweise von grundloser Angst und Trübsinn. […] Nur gestört ist der Melancholiker im Gegensatz zum Irren und Wahnsinnigen, bei dem die Hirnfunktionen nicht in Unordnung, sondern ganz ausgefallen sind«. Angst und Sorge grenze sie von gewöhnlichem Irrsinn ab, Angst und Sorge seien die wahren Kennzeichen und unzertrennlichen Weggefährten der meisten Schwermütigen. Er diskutiert, welche Organe hauptsächlich befallen würden, entscheidet sich dann für das Hirn, denn als Geistesstörung müsse die Melancholie dieses Organ in Mitleidenschaft ziehen. Das sei die Position des Hippokrates, des Galen, der arabischen Medizin und der meisten modernen Heilkundigen. Später diskutiert er dann »das Dreierschema« und beschreibt als Ersterkrankungsform die Kopfmelancholie, die allein vom Gehirn ausgelöst werde, die Zweite betreffe den ganzen Körper, in dem die schwarze Galle aus dem Gleichgewicht geraten sei, die Dritte rühre her von Eingeweiden, der Leber, Milz oder dem Gekröse und werde hypochondrische oder blähende Melancholie genannt, wobei die Liebesmelancholie im Allgemeinen zur Kopfmelancholie gerechnet werde. Als Ursachen melancholischer Erkrankungen werden Gott, die Sterne, das Alter, die Vererbung, die Ernährungsgewohnheiten, Betrübnis und Kummer, Scham und Schande, Furcht, Verdruss, Sorgen und Not, aber auch Rivalität, Hass, Rachedurst oder auch Eigenliebe, Aufgeblasenheit, grenzenloser Beifall, Stolz und übermäßige Freude sowie der Verlust der Freiheit, Knechtung und Gefangenschaft diskutiert. Später schreibt er »keine körperliche Qual kommt der Melancholie gleich, keine Folterwippe, keine heißen Eisen und glühenden Ochsen des Phalaris, und selbst die sizilianischen Tyrannen haben keine schlimmere Tortur erdacht. Alle Ängste, Kümmernisse, Unzufriedenheiten, aller Argwohn, alles Ungute und auch alle Unannehmlichkeiten münden und verlieren sich wie Bächlein in diesen Euripus, dieser Irische See, dieser Ozean des Elends, diesen Zusammenfluss allen Grams, […].« (S. 327). Zum Thema Suizid schreibt er: »Selten endet die Melancholie tödlich, außer in den Fällen – und das ist das größte und schmerzlichste Unglück, das äußerste Unheil –, in denen ihre Opfer Selbstmord begehen, was häufig geschieht. So haben schon Hippokrates und Galen feststellen müssen: Wenngleich sie den Tod fürchten, legen sie doch meistens Hand an sich, und das wird aller ärztlichen Kunst zum Verhängnis […]. Ihr äußerstes Elend peinigt und quält diese Menschen derart, dass sie keine Freude mehr am Leben finden und sich gleichsam gezwungen sehen, sich den Kelch abzutun, um ihr unerträgliches Leid abzuschütteln. So begehen […] einige in einem Anfall von Raserei, die meisten aber aus Verzweiflung, Sorge, Angst und Seelenpein Selbstmord, denn ihre Existenz ist unglücklich und jammervoll« (S. 325). Robert Burton (1577–1640) war Theologe, Mönch und Gelehrter am Chris Church College der Universität Oxford. Er schrieb das Buch »Anatomie der Melancholie« als Selbstbetroffener, es kostete ihn seine gesamte Schaffenskraft, so dass nur wenig Sonstiges von ihm erhalten ist.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Depressionen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Depressionen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Depressionen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.