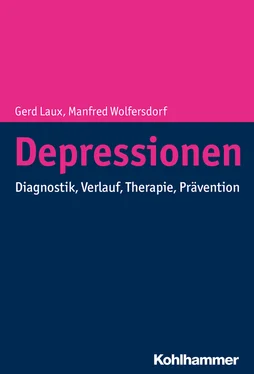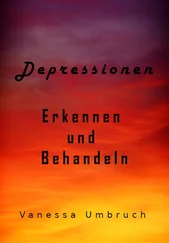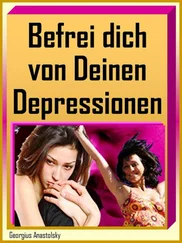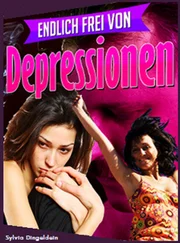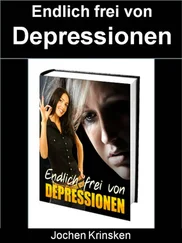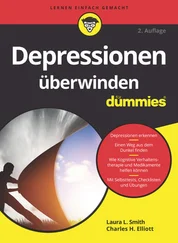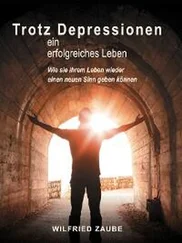Manfred Wolfersdorf - Depressionen
Здесь есть возможность читать онлайн «Manfred Wolfersdorf - Depressionen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Depressionen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Depressionen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Depressionen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Depressionen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Depressionen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Romano Guardini (1928–1983) meinte in »Vom Sinn der Schwermut«: »Die Schwermut ist etwas zu schmerzliches, und sie reicht zu tief in die Wurzeln unseres menschlichen Daseins hinab, als dass wir sie den Psychiatern überlassen dürften [Romano Guardini 1949]. Wir glauben, es geht um etwas, was mit den Tiefen unseres Menschtums zusammenhängt.« Romano Guardini spricht damit etwas an, was sich durch die gesamte Literatur und das Denken zur Melancholie und Depression zieht, nämlich die Unschärfe der Trennung der Krankheit Depression von der »melancholischen Gestimmtheit« und er meint damit ein menschliches Phänomen, das per se keine Krankheit ist, aber zu einer werden kann. Romano Guardini war selbst depressiv erkrankt.
Schott und Tölle (2006, S. 402 ff.) schreiben, die Melancholie gelte in der abendländischen Medizingeschichte als eine Hauptkrankheit, die nach der antiken Humoralpathologie (Vier-Säfte-Lehre) von der (hypothetischen) schwarzen Galle herrühre. Die schwarze Galle solle vor allem mit der Milz in Beziehung stehen und vom Hypochondrium bzw. der Kardia (Magenmund) aus auch andere Körperregionen infizieren. Dabei habe die aus dem Bauch in den Kopf aufsteigende Melancholie (Melancholia hypochondriaca) in der allgemeinen Krankheitslehre bis ins 19. Jahrhundert hinein eine wichtige Rolle gespielt. Unzählige Vorstellungen seien im Zusammenhang mit der Melancholie seit der »Schwarzgalligkeit« der griechischen Medizin vorgelegt worden. »Im Begriff der Melancholie spiegelt sich wie in keinem anderen die gesamte abendländische Medizingeschichte wider«. Das sei gerade bezüglich des Leib-Seele-Verhältnisses, der medizinischen Anthropologie und der psychiatrischen Therapeutik höchst aufschlussreich. Dies erinnert erneut stark an die Aussage von Romano Guardine, die Melancholie nicht nur den Psychiatern überlassen zu können.
Nach Schott und Tölle (2006) (S. 406) neigen Psychiatriehistoriker dazu, der mittelalterlichen Heilkunde generell eine »dämonologische Interpretation der Geisteskrankheiten« zu unterstellen, um sie somit von den rationalen Krankheitsmodellen der Antike und den naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritten der Neuzeit abzugrenzen. Für Schott und Tölle ist dies eine Variante der Legende vom finsteren Mittelalter. Hole und Wolfersdorf (1986, S. 440) haben gezeigt, dass die Verallgemeinerung, dass im Mittelalter die somatische Grundlage der Melancholie zugunsten einer »dämonologischen Interpretation« aufgegeben worden sei, falsch ist. Die Medizin des Mittelalters stand durchaus in der Tradition der antiken Lehre, die keineswegs zugunsten der Dämonologie aufgegeben wurde, wenngleich religiöse und teilweise auch dämonologische Anschauungen integriert wurden. Nach Hildegard von Bingen schien etwa bei der viel zitierten »Mönchskrankheit« (Acedia) die schwarze Galle als Ausdruck der Sünde (der mönchischen Nachlässigkeit) eine Melancholie zu erzeugen, wie sie es schon in Adams Körper in Folge des Sündenfalls getan habe. Melancholie schwäche in dieser Sicht die Abwehrkräfte gegen Dämonen und disponiere somit zur Besessenheit.
Johann Baptist van Helmont (1579–1644), ein bedeutender Mediziner des 17. Jahrhunderts und Wegbereiter der chemischen Medizin aus dem Geiste der Alchemie, hat den Zusammenhang von Melancholie und Imagination beschrieben. Er lehnte die Vier-Säfte-Lehre der schwarzen Galle ab, zumal er sie nicht gefunden habe, sondern spricht von einem »Fehler des Lebens-Geistes«, wobei die Einbildungskraft (Imaginatio), welche die krankmachenden Bilder (Ideae morbosae) eine entscheidende Rolle spielten. Damit sind wir beim Saturn als Stern der Melancholiker angelangt. Van Helmont hält an der astrologischen Lehre fest, dass der Saturn als »Irrstern« über die Milz seinen üblen Einfluss ausübe, es entstünden dort durch Einbildung und Fantasie krankmachende Bilder, die quasi als Krankheitssamen den Lebensgeist im Magen so stark beeindruckten, dass eine Krankheit entstehe.
Neben den biologischen (Vier-Säfte-Lehre) und astrologischen (Saturn) sowie theologisch ergänzten (Vier-Säfte-Überlegungen, Hildegard von Bingen) gibt es auch psychologische und tiefenpsychologische Überlegungen zur Entstehung der Melancholie. Der französische Psychiater Pinel (1800, S. 66) soll als Ursache der Melancholie »Traurigkeit, Schrecken, anhaltendes Studieren, die Unterbrechung eines thätigen Lebens, heftige Liebe, das Uebermass in den Vergnügungen, Missbrauch betäubender und narkotischer Mittel, vorübergehende Krankheiten, die unrichtig behandelt wurden, die Unterdrückung des Hämorrhoidalflusses« gesehen haben. Esquirol (1816 S. 30 ff.) bezeichnete die Melancholie als »Lypémanie« (griechisch Lype ist gleich Betrübnis, Ärger, Schwermut) und schreibt: »Das Delirium bezieht sich nur auf einen oder eine kleine Anzahl von Gegenständen mit einer vorherrschenden traurigen oder niederdrückenden Leidenschaft«. Außerhalb der Psychiatrie wird der Begriff Melancholie häufig in Literatur, Kunst und Sonstigem in einem anderen Sinne verwendet. Dabei wird ein Zusammenhang zwischen der Melancholie und der künstlerischen Kreativität hergestellt, also zwischen »Krankheit und Genie«.
In einem eigenen Kapitel (S. 411 ff.) differenzieren Schott und Tölle zwischen »Melancholie und Depression«. Melancholie sei der ältere Begriff, mit einer mehr als 2.000-jährigen Verwendung, allerdings nur im Hinblick auf das Erscheinungsbild der Krankheit, nicht bzgl. der Theoriebildung. Heute spricht man nicht mehr von Melancholie und auch das Adjektiv »melancholisch« wird kaum verwendet. Der Begriff »Depression« tauchte anscheinend erst um 1800 auf und soll auf eine Anregung des schottischen Arztes William Cullen zurückgehen. William Cullen (1885, S. 57) war besonders interessiert an Nervenkrankheiten und bezeichnete sie als »Neurosen« (Morbi nervosi), er erklärte die Melancholie als Gehirnkrankheit und behauptete, die Krankheit sei vom »Grad der Festigkeit der Substanz des Gehirns« abhängig. Der Begriff Depression wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts immer häufiger benutzt. Heinroth (1825, S. 118) definierte die »Depression« als ein »Übermaß an Passivität«. Die französische Psychiatrie sprach noch von Melancholie, aber gleichbedeutend mit dem Begriff Depression. Im 20. Jahrhundert verwendeten den Begriff Melancholie eher anthropologisch orientierte Psychiater wie L. Binswanger oder H. Tellenbach. Der Begriff Depression erfuhr einen Bedeutungsverlust, indem man nur noch »irgendein Herabgestimmtsein« ohne Differenzierung meinte.
Die deutschsprachige Psychiatrie unterschied bis zur ICD-10 zwischen drei Kernformen von depressiven Erkrankungen: 1) endogene monopolare, monophasische oder rezidivierende Depressionen, 2) exogene Depressionen, zu denen auch somatogene, also aus der körperlichen Sphäre stammende zählten, und 3) psychogene Depressionen, die reaktiven, die neurotischen und die Entwicklungen. Allerdings gibt es auch in der ICD-10 noch die »melancholische« Depression, wenn man sich genauer das somatoforme Syndrom anschaut, welches eben biologische sprich melancholische Symptomatik enthält.
Über Jahrhunderte ist die Krankheit Melancholie im Kern übereinstimmend beschrieben worden. Paracelsus (sämtliche Bände Oldenbourg 1929–1933) schrieb im Band 12 (S. 42): »Melancholia ist ein krankheit, die in ein menschen falt, das er mit gewalt traurig wird, schwermütig, langweilig, verdrossen, unmutig und falt in seltsam gedanken und speculationen, in traurigkeit, in weinen etc., wie dan das gemüt an im selbs anzeigt.«
László F. Földényi (1988), ungarischer Dichter und Schriftsteller, eröffnet sein Buch im Vorwort mit dem Satz »Der Beginn unter Qualen zeugt von der Schwierigkeit des Unterfangens.« Darüber hinaus schreibt er im letzten Kapitel seiner Einführung: »Zu jener Zeit, da die Melancholie zum erstenmal als Begriff erschien, war über sie schon alles gesagt worden. Doch von Anbeginn an ist die Ungenauigkeit des Begriffs, auch der an spätere Epochen nichts ändern konnten, auffallend. Es gibt keine eindeutige oder genaue treffende Bestimmung der Melancholie. Die Geschichte der Melancholie ist auch die Geschichte einer nie zum Abschluss kommenden Präzisierung der Begriffsprägung und gerade daraus ergibt sich auch der Zweifel: sprechen wir über die Melancholie, so ist sie gar nicht Gegenstand unseres Sprechens, es handelt sich vielmehr um einen Versuch, mit den über sie geprägten Begriffen unsere eigene Lage zu erkennen.« (S. 12–13). Der Autor steigt in sein Thema dann mit einem überraschenden Satz ein: »Warum erweisen sich alle außergewöhnlichen Männer in Philosophie oder Politik oder Dichtung oder in den Künsten als Melancholiker?« Und er meint, dass dieser Satz, der aus der Schule des Aristoteles stammte, an seiner Gültigkeit bis in die heutige Zeit nichts eingebüßt habe. Das Gemüt und die Gestalt, der Geist und der Körper sowie die Melancholie sei ihre Krankheit, die Einheit der Seele und die auch den körperlichen Zustand bestimmende Vermengung der kosmischen Elemente. Das sich Auflösen und das Erkranken dieser Zweiheit sei die Melancholie und der Autor fragt, ob es denn eine ärztliche Anschauung gebe, die großzügiger und mütiger wäre. Die Melancholie als Krankheit sei, so in Anlehnung an Hippokrates, daher das »Ergebnis einer Art von Entgleisung, das Gleichgewicht von Mikro- und Makrokosmos hat sich verlagert, die Ordnung (der Kosmos) hat sich gelockert, es hat sich eine Störung eingestellt, und die betroffene Person ist nicht mehr in der Lage, den untrennbaren Gesetzen des Alls und des eigenen Schicksals zu gehorchen.« (S. 19). Weiter schreibt er: »Das Verstehen der Melancholie als endokosmogene Depression dehnt den Begriff derart aus, dass die streng objektivistische Medizin zurecht das Gefühl haben kann, dass man ihr die Basis entzogen hat. Es scheint, als ob ein schicksalhafter Relativismus nicht nur zwischen körperlichen und seelischen Krankheiten die Grenze verwische, sondern auch die Beziehung zwischen Erkrankung und Gesundheit relativieren würde.« (S. 296). Darüber hinaus führt er aus, was er unter Melancholie versteht: »Die Traurigkeit und die Angst, die den Melancholiker befallen, sind der im alltäglichen Sinne verstandenen Übellaunigkeit oder Furcht nicht gleich. Der Melancholiker ist traurig, blickt aber auch auf diese Traurigkeit: er ist sich darüber, dass es ein »sinnloses« Unterfangen ist, zu trauern, im Klaren und verhält sich zu seiner Traurigkeit wie zu einem Gegenstand. Er trauert, und dennoch hat er nichts mit seinem eigenen Zustand zu schaffen und deshalb ist er auch nicht zu trösten.« (S. 346).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Depressionen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Depressionen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Depressionen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.