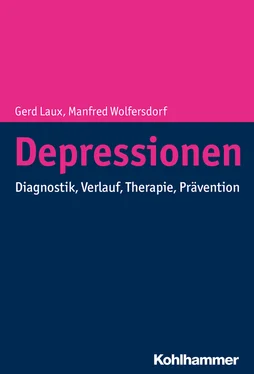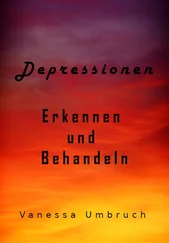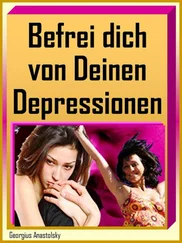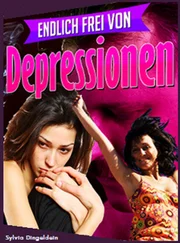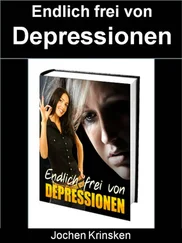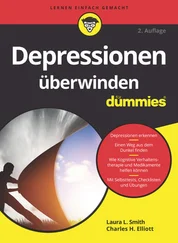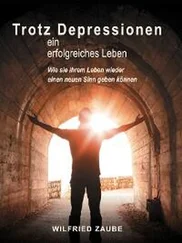Manfred Wolfersdorf gründete 1976 mit seinem Team am Psychiatrischen Landeskrankenhaus Weissenau die »erste Depressionsstation« in Deutschland, Gerd Laux die zweite im Psychiatrischen Landeskrankenhaus Weinsberg. Für Ersteren lag der Behandlungsschwerpunkt in der psychodynamisch-tiefenpsychologischen Psychotherapie, fachliches Spezialgebiet wurde die Suizidologie, die Suizidprävention und die Frage, warum Menschen sich das Leben nehmen. Gerd Laux widmete sich der differenzierten Behandlung mit Antidepressiva (einschließlich Infusionstherapien und Therapeutischem Drug Monitoring), von denen neue Generationen von Präparaten in der Entstehung waren. Als Arzt und Psychologe spezialisierte er sich auf die Verkehrsmedizin und -psychologie (Fahrtauglichkeitsuntersuchungen), psychotherapeutisch lag der Schwerpunkt im Bereich (kognitive) Verhaltenstherapie und interpersonell-humanistischer Psychotherapie.
Heute sind Depressionen zur »Volkskrankheit« geworden. Die Beschreibung des Krankheitsbildes und die Definition der diagnostischen Kriterien erfuhr durch die ICD-10 und vor allem durch das Diagnostische und Statistische Manual (DSM-III bis nun DSM-5) der amerikanischen Psychiatrie eine deutliche Erweiterung. »Depressive Störungen« umfassen nun ein großes heterogenes Spektrum, dessen Grenzen unscharf geworden sind. Die unglückliche Festlegung, dass bei Vorliegen einer »depressiven Episode« nach ICD-10 diese als Achse I-Diagnose an erste Stelle gestellt werden müsste, führte bereits vor Jahren zu den kuriosen Auswüchsen, dass in einem Standardversorgungsfachkrankenhaus plötzlich zwei Drittel aller Patienten unter einer F3-Störung litten.
Das Stigma »Ich bin doch nicht verrückt« scheint bei depressiven Störungen am geringsten ausgeprägt zu sein, die Inanspruchnahme von fachlicher Hilfe auch bei leichten oder mittelschweren depressiven Erkrankungen scheint zugenommen zu haben, zumindest hört man dies von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sowie Ärztlichen und Psychologischen Psychotherapeuten, bei denen ein gutes Drittel bis manchmal die Hälfte aller Patienten solche mit primären depressiven Erkrankungen sind.
Aktuell besteht eine Diskrepanz (»Gap«) zwischen einer mit hohem Aufwand betriebenen internationalen (Grundlagen-)Forschung einerseits und einer unbefriedigenden Versorgungsrealität anderseits. Trotz immenser Forschungsbemühungen im Feld der Genetik, der Neurobiochemie, der Endokrinologie, der Psychoimmunologie, der Bildgebung und der Psychotraumatologie bleiben die Ursachen auch für Subtypen von Depressionen im hypothetischen Bereich »multifaktorieller und biopsychosozialer Modellvorstellungen«. Es gelang bisher nicht, die Wirksamkeit der ersten trizyklischen Antidepressiva zu verbessern, zerebrale Stimulationsverfahren wie die Transkranielle Magnetstimulation erreichen nicht die Wirksamkeit der in Deutschland immer noch tabuisierten Elektrokrampftherapie. Im Bereich der Psychotherapie wurden in der Nachfolge und z. T. aus den klassischen verhaltenstherapeutischen und tiefenpsychologisch-psychoanalytischen Konzepten störungsspezifische Verfahren für depressiv Kranke entwickelt; so die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT), die Interpersonelle Psychotherapie (IPT) und speziell für chronische Depressionen das »Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy« (CBASP). Jüngst hält die sog. »Online-Psychotherapie« (Internet-basierte kognitive Verhaltenstherapie) Einzug in die moderne zeitgemäße Depressionsbehandlung. Die Zahl der Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, der Ärztlichen Psychotherapeuten und insbesondere der Psychologischen Psychotherapeuten in Deutschland hat zugenommen – dennoch bleiben depressive Patienten in manchen Regionen unversorgt und circa 30 % der Depressionen gelten als »therapieresistent« bzw. nehmen einen chronischen Verlauf.
Konzeptuell legen wir ein Buch mit persönlichen Akzenten vor: Einerseits enthält es wissenschaftlich-empirische Fakten im Sinne der evidenzbasierten Medizin (auf den klinischen Alltag bezogen und mit der Einschränkung, dass die Autoren sie so schildern, wie sie auch von ihnen erlebt wird), andererseits erlauben wir uns die Wiedergabe unserer persönlichen Sicht, basierend auf unseren langjährigen praktischen klinischen Erfahrungen. Diese persönlichen Anmerkungen werden im Folgenden durch einen eingefärbten Kasten hervorgehoben. Das große Spektrum depressiver Störungsbilder verdeutlichen wir durch Kasuistiken und damit »Patientenschicksale« aus dem eigenen Erfahrungsbereich, anonymisiert und auf Vignetten zur Darstellung des Wesentlichen reduziert. Vor allem zu den Themenkreisen Häufigkeit und Ursachen von Depressionen erlauben wir uns gesellschaftliche, sozialwissenschaftliche und zeitgeistkritische Überlegungen. Wir hoffen, so etwas Licht in den Nebel der »Allerweltsdiagnose Depression« bringen zu können.
Wir danken dem Kohlhammer Verlag, der sich mit uns auf dieses Projekt eingelassen hat, unseren Sekretärinnen für ihre langjährige Unterstützung und unseren Patienten, die uns lehrten, was es heißt, »depressiv krank« zu sein.
Im September 2021
| Manfred Wolfersdorf Bayreuth/Hollfeld |
Gerd Laux Soyen/Waldkraiburg/München |
1Im Text wird aus Gründen der Vereinfachung das generische Maskulinum verwendet; gemeint sind immer Frauen und Männer.
1 Depression, Melancholie: Historische Aspekte
Warum ist es sinnvoll, sich mit »Psychiatrie-Geschichte« zu beschäftigen, hier mit der Geschichte des Depressionsbegriffes bzw. der »Melancholie«, wie er früher genannt wurde? Zum einen erklärt das Wissen um die Entstehung des eigenen Faches, des Berufsstandes und der verwendeten Krankheitsbegriffe den heutigen Status in der gesundheitspolitischen und medizinischen Versorgung von Menschen und natürlich auch das Problem mit dem heute überbordenden Begriff der »depressiven Episode«. Die spezifischen naturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, kulturspezifischen und im engeren Sinne medizinischen Fragen der Psychiatrie und hier bzgl. des Krankheitsbegriffes Melancholie/Depression, von der Symptombenennung über den Norm- und Krankheitsbegriff bis hin zur Psychodynamik, zu Ätiopathogenesekonzepten und zu psychosozialen und sozialpsychiatrischen Themen sind nur aus der Historie zu verstehen. »Depression« einfach als »depressive Episode« operationalisiert zu definieren und damit verstehen zu wollen, führt nicht zu einem vertieften Verständnis depressiv kranker Menschen, sondern bleibt an einer dünnen Oberfläche. Nur der Blick zurück führt zum Verständnis der Gegenwart und zu Perspektiven für eine Zukunft – die für Depressive besonders wichtig ist. Was bei jeder Befunderhebung für eine biografische Anamnese gilt, trifft auch auf das Verständnis von Psychiatrie und hier von Depression/Melancholie zu.
Versucht man eine – zugegebenermaßen ausgesprochen grobe – Gliederung der Geschichte der Psychiatrie zu erstellen, dann kann man drei große Zeiträume unterscheiden. Einen ersten Zeitraum, der vom Altertum bis ca. Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts reicht und den man mit »Geschichte des Wahnsinns« überschreiben könnte. Hier ging es um Fragen des »Raptus melancholicus«, um Wahn und Genie, um Tollheit u. ä. Die Psychiatriegeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts ist im engeren Sinne eine Geschichte der sich entwickelnden Krankenhauspsychiatrie, in der nun der krankhafte Aspekt psychischen Andersseins erkannt und akzeptiert wird und die Herausnahme aus der Gesellschaft (»Verwahrung«) und die Pathologie im Vordergrund stehen. Ein dritter Zeitabschnitt beginnt im 20. Jahrhundert und reicht bis in die Gegenwart und sicher weiterhin, der die »Geschichte der Psychiatrie als medizinisches Fach, als Behandlungsauftrag und als Forschungsgegenstand« versteht und in dem wir mit unserer heutigen Problematik um den Begriff »Depression« bzw. die Geschichte der Melancholie angesiedelt sind. Gaebel und Müller-Spahn (2002) haben Psychiatrie bezeichnet als eine »medizinische Disziplin, die sich mit der mehrdimensionalen Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und Prävention psychischer Störungen in einem vernetzten System spezialisierter Behandlungseinrichtungen befasst […] und Gegenstand der Psychiatrie sind psychische Störungen«.
Читать дальше