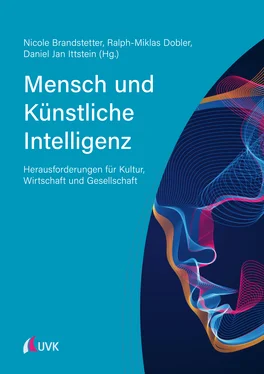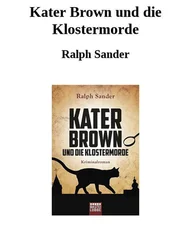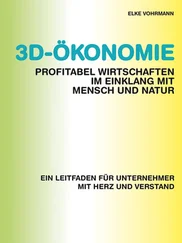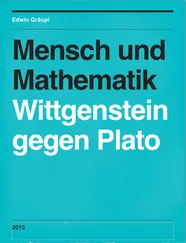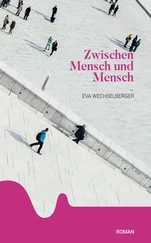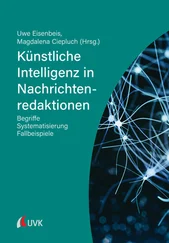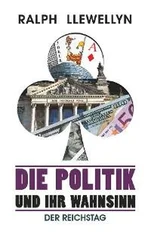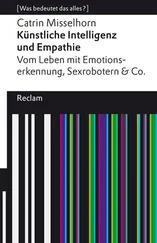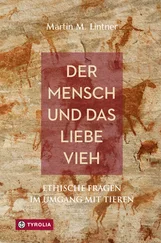Die Aufgabe des Roboters ist dabei die künstliche Mutterschaft. Aus einer Vielzahl von Embryonen wählt der Mutterersatz einen aus, den sie dann als „Tochter“ großzieht. In dem Kammerspiel zwischen Mensch und Maschine zeigt sich Mutter in ihrem Umgang mit Tochter äußerst sanft und rücksichtsvoll. Die Robotermutter führt eine scheinbar harmonische Beziehung zu dem Menschenmädchen. Mutter ist ein nahezu perfekter Elternersatz, was trotz allem nicht nur unnatürlich wirkt, sondern auch Unbehagen auslösen kann. Als in der Geschichte eine fremde Frau auftaucht, ändert sich jedoch die Beziehung zwischen Roboter und Mädchen. Die Handlung kommt hier zu ihrem Wendepunkt. Im Gegensatz zu den anderen Filmen, ist in I am Mother nicht die KI das Fremde, sondern die menschliche Frau. Dies ist darin zu begründen, dass Tochter bisher lediglich ihre Robotermutter kannte und als Norm anerkannte. Doch das Mädchen gerät allmählich ins Zweifeln, da der fürsorgliche Mutterroboter von der Frau aus der Außenwelt als Feind deklariert wird. Mutter wird daraufhin aggressiver, weil sie in der Erwachsenen eine Bedrohung für ihre Mission sieht. Zum Schluss zeigt sich, dass nämlich die Hauptaufgabe des Mutterroboters darin besteht, die fehlerhaften Menschen durch von Maschinen aufgezogene perfekte Menschen zu ersetzen. Die KI hinter Mutter, welche als kollektives Bewusstsein alle Roboter lenkt, löschte höchstwahrscheinlich in der Vergangenheit die Menschheit mitsamt seinen Fehlern aus, um die Erde mit fehlerlosen Menschen neu zu bevölkern. Dabei fällt auf, dass die Maschine vor allem die Neugier des Menschen stört, welcher als ein zentraler Antrieb der menschlichen Entwicklung gedeutet werden kann. Hier ist zu vermuten, dass die Abwesenheit von Neugier für die Maschine als Perfektion verstanden wird, da Maschinen dieses Verlangen nicht besitzen. Als Tochter sich von der Neugier abwendet und ihr Dasein im Bunker akzeptiert, werden die Rollen getauscht und Tochter übernimmt Mutters Aufgabe, indem sie von nun an selbst weitere Menschen großziehen wird. Sie hat den Test der KI bestanden und wird von ihr als geeignet betrachtet, die neue Menschheit nach den Maßstäben der Maschinen großzuziehen. Dabei wirft der Film neue Fragen zum Thema künstliche Elternschaft auf. Neuartig ist die Positionierung des Menschen an der Seite der Maschine. Waren bisher Menschen nebeneinander verortet, sind sie sich nun einander fremd. Auch wenn I am Mother sich ebenfalls der Thematik der Auslöschung der Menschheit durch KI bedient, vermag es der Film dennoch die starren Konstrukte von guten und bösen Absichten aufzubrechen, sodass eine eindeutige Bewertung kaum möglich erscheint und das Feindbild nicht eindeutig zugeordnet werden kann.
Die aufgeführten Filmbeispiele zeigen, dass sich die Darstellung von KI im Film zwar stetig ändert, viele Filme sich jedoch noch immer ähnlicher Muster und narrativer Elemente bedienen. KI sind entweder Verheißung oder Verhängnis, es gibt kaum Spielraum für Kompromisse. Die Künstlichen Intelligenzen werden programmiert, um den Menschen zu unterstützen, doch zeigt sich insbesondere bei den körpergebundenen KI, dass sie lediglich als moderne Form des Sklaven für ihre Besitzer*innen dienen. Die Fragen Wer? Wen? Wozu? lassen sich immer wieder gleich beantworten: Wer? ist der Mensch, Wen? ist die KI und Wozu? ist die Funktion als untergeordnetes Werkzeug der Menschheit. KI unterstehen dem Menschen, wobei eine friedliche Ko-Existenz ausgeschlossen ist. Die emanzipative Subjektwerdung der KI resultiert zumeist im Krieg zwischen Mensch und Maschine. Vor allem in den älteren Filmen sind Maschinen das Feindbild der Menschheit. Dabei kommt es zu kognitiven Verzerrungen, sogenannten Bias , die zu falschen Darstellungen tatsächlicher Verhältnisse führen. Erst ab der Jahrtausendwende werden zunehmend auch positive Eigenschaften künstlicher Intelligenzen aufgezeigt und Chancen der Mensch-Maschine-Kooperation diskutiert.
Bei den Fragen, wie viel Realität in der Fiktion steckt und wie viel Einfluss die eine auf die andere hat sind keine eindeutigen Antworten möglich. Einerseits gibt es zwar bereits Erfindungen, deren Vorbild Ideen aus der Science-Fiction sind, z. B. Tablets wie in Star Trek . Andererseits sind humanoide Roboter, die über eine künstliche Intelligenz verfügen, nicht im Mittelpunkt der Forschung um KI. So finden aktuelle Thematiken, wie bspw. Big Data und Machine Learning , kaum Erwähnung in Hollywood-Blockbustern. Die Fiktion beschäftigt sich dabei immer wieder mit der Verarbeitung philosophischer Fragen, inwiefern sich der Mensch von der KI unterscheidet oder gar welche Rechte der KI zustehen sollten. Literatur und Film vermögen es als Spiegel der technisierten Gesellschaft die Chancen und Risiken der fortschreitenden wissenschaftlichen Entwicklung aufzuzeigen und können somit den ethischen Diskurs um verschiedene Perspektiven erweitern. So sollte die Fiktion vor allem aber auch dazu dienen die menschliche Arroganz und den Hochmut aufzuzeigen, um die Selbstreflektion des Menschen anzuregen, welche einen enormen Einfluss auf die Zukunftsgestaltung hat.
Deulgaonkar, Parag: „World’s first ‘Robocop’ joins Dubai Police force“, Arabian Business , 21 May 2017. [online] Available at: < https://www.arabianbusiness.com/world-s-first-robocop-joins-dubai-police-force-674837.html> [Accessed 2 Oct 2020].
Dyck, Andreas: „Künstliche Intelligenzen in der Science Fiction: In diesen Filmen spielt KI die Hauptrolle“, General Anzeiger , 27 Sept 2018. [online] Available at: < https://ga.de/news/kultur-und-medien/ueberregional/in-diesen-filmen-spielt-ki-die-hauptrolle_aid-43913153> [Accessed 10 March 2021].
Gesellschaft für Informatik e. V.: Allensbach-Umfrage: Terminator und R2-D2 die bekanntesten KIs in Deutschland , 2019. [online] Available at: < https://gi.de/meldung/allensbach-umfrage-terminator-und-r2-d2-die-bekanntesten-kis-in-deutschland> [Accessed 21 March 2021].
Haraway, Donna: „A Cyborg Manifesto“, The Cultural Studies Reader , 3rd ed., edited by Simon During, New York, Routledge, 2007 [1984], pp. 314-334.
Hollinger, Veronica: „Feminist Theory and Science Fiction“, The Cambridge Companion to Science Fiction , edited by Edward James and Farah Mendlesohn, Cambridge UP, 2003, pp. 125-136.
Hollywood, Samantha: „Descartes Goes to Hollywood: Mind, Body and Gender in Contemporary Cyborg Cinema“, Body and Society , Vol. 1(3-4). London et al., Sage, 1995, pp. 157-174.
Le Guin, U. K.: The Last Interview and Other Conversations. Melville House, 2019.
Mulvey, Laura: „Visual Pleasure and Narrative Cinema“, Film Theory and Criticism: Introductory Readings , edited by Leo Braudy and Marshall Cohen, New York, Oxford UP, 1999, pp. 833-44.
Seabrook, John: „Why Is the Force Still with Us?“, The New Yorker , 30 Dec 1997. [online] Available at: < https://www.newyorker.com/magazine/1997/01/06/why-is-the-force-still-with-us> [Accessed 2 Aug 2020].
Watson R.: „Uncanny Valley – Das Phänomen des ‚unheimlichen Tals“, 50 Schlüsselideen der Zukunft , Berlin, Heidelberg, Springer Spektrum, 2014, pp. 136-139.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.