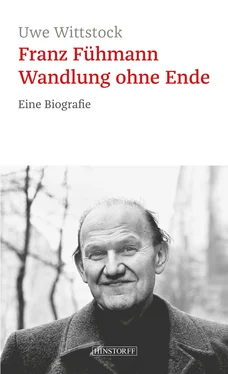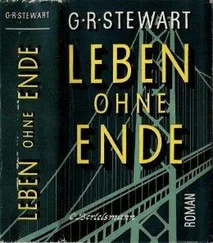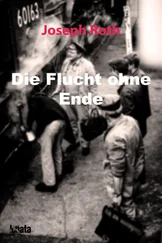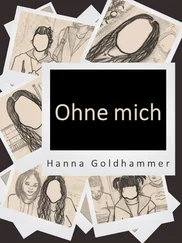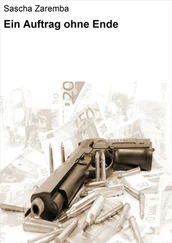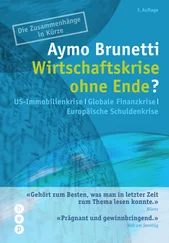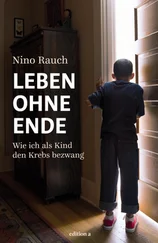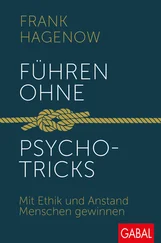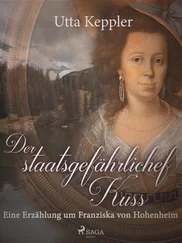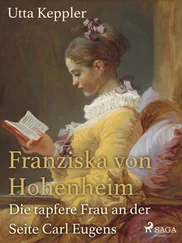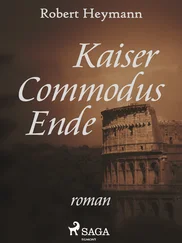Auch die Mutter tritt nicht als zärtliche Beschützerin oder auch nur Vertraute des Kindes auf, sondern als ein streitsüchtiger, bigotter Hausdrachen. Nie ist in diesen Geschichten von Geborgenheit oder selbstverständlicher familiärer Zusammengehörigkeit die Rede. Keiner der Erwachsenen nimmt Rücksicht auf die Gefühle des Jungen, niemand geht auf ihn ein oder beschäftigt sich länger mit ihm, als dies für zwei, drei Befehlssätze notwendig ist. Fühmanns kindlicher Held macht daher oft einen einsamen, isolierten Eindruck: Er spielt allein, hat offenbar kaum Freunde und lebt umstellt von Anweisungen oder Verboten, die mit drakonischen Strafen durchgesetzt werden. Die Anerkennung seiner Eltern muss er sich durch Willfährigkeit und schulische Erfolge regelrecht erkämpfen. Er lernt auf diese Weise frühzeitig, die eigenen Bedürfnisse und Neigungen zu unterdrücken, sich selbst – oder zumindest das Bild, das er von sich erweckt – nach den Ansprüchen der Außenwelt zu formen. Gefragt ist, darüber wird sich der Junge bald schon klar, ein starker, mutiger, kluger Sohn, der allerdings die Meinungen von Vater oder Mutter jederzeit kritiklos übernehmen und der ihren Wünschen ohne Widerspruch folgen soll. Jeder Einspruch oder gar Widerstand gegen die Entscheidungen einer Autoritätsperson wird nicht als Ausdruck der kindlichen Individualität, sondern als der Beleg für einen bedenklichen Charakterfehler betrachtet und wie ein Vergehen geahndet.
Welche Konsequenzen diese Jugend für den späteren politischen Werdegang Fühmanns zeitigte, ist nur zu offensichtlich. Die Erziehung, die er durchlebt hatte, zielte nicht darauf, seine Persönlichkeit zur Selbstständigkeit zu formen, sondern sie gefügig zu machen. Und er brauchte lange, um die Spuren, die jene Zeit in seinem Verhalten hinterlassen hatte, auch nur zu erkennen, geschweige denn zu überwinden: Während der nationalsozialistischen Herrschaft und ebenso während der ersten Jahre in der DDR erwies er sich geradezu als Paradebeispiel einer autoritären Persönlichkeit. Er war allzu rasch bereit, Meinungen zu übernehmen, sich den Ansprüchen der Außenwelt zu fügen und seine eigenen Empfindungen oder Wünsche beiseitezuschieben. Wie er es in seiner Kindheit gelernt hatte, versuchte er Anerkennung durch Verzicht auf die eigenen Bedürfnisse, durch Unterwürfigkeit und Gehorsam zu erwerben. Zweifel an staatlichen Autoritäten offen zu äußern war seine Sache nicht. Immer wieder stellte er sich bis an die Grenze der Selbstverleugnung in den Dienst der jeweiligen öffentlichen Sache, über deren Wert oder Unwert er freilich nicht zu urteilen, ja noch nicht einmal gründlich nachzudenken wagte.
So detailliert und anschaulich Fühmann diesen Prozess der Zurichtung eines Kindes zum Untertanen auch schildert – seine Erzählungen bleiben dennoch erstaunlich zurückhaltend. Die Leidensgeschichte des Jungen wird distanziert wie hinter einer Glasscheibe vorgeführt. Man beobachtet ein brillant kalkuliertes Lehrstück: Ganz selten nur werden der kindlichen Hauptfigur aufwühlende Worte des Schmerzes oder der Sehnsucht gestattet. Wie sehr sie unter dem Mangel an Zuneigung und Anteilnahme leidet, bleibt fast unausgesprochen, denn was sie niemals kennenlernte, kann sie naturgemäß auch nur schwer benennen. Geborgenheit und Elternliebe bilden mithin so etwas wie schmale, aber abgründige Leerstellen in diesen Erzählungen. Der Autor appelliert an den Verstand des Lesers und nicht allein an dessen Mitgefühl. Er will erklären und nicht sich beklagen. Seine Geschichten ähneln eher einer Analyse als der Abrechnung mit einer verpfuschten Kindheit.
Mehr noch: Fühmann spricht sein Alter Ego – ohne Rücksicht auf dessen Alter – keineswegs von jeder aktiven Beteiligung am eigenen Schicksal frei. Er drängt den Knaben nicht in die Rolle eines willenlosen Opfers. Seine distanzierende Erzählweise hebt vielmehr die indirekte Mitwirkung des Kindes hervor. Die Verantwortung für seine Entwicklung und seinen späteren Lebensweg wird somit nicht ganz und gar auf die Eltern mit ihren brachialen Erziehungsmethoden abgeschoben. Selbstmitleid, und sei es nur in schüchternen Ansätzen, war Fühmann verhasst. Im Zweifelsfall ist er mit sich lieber zu streng als zu sanftmütig ins Gericht gegangen, auch wenn er auf diese Weise viel von den psychischen Nöten seiner Jugend verschwiegen oder bagatellisiert hat. In dieser Härte, mit der sich Fühmann zeitlebens selbst behandelte, machen sich wohl noch die Spätfolgen jenes Drills bemerkbar, dem er in seinen frühen Jahren ausgesetzt war.
Wie es um das Seelenleben des Kindes wirklich bestellt war, lässt sich vielleicht an einer scheinbar objektiven, unpersönlichen Bemerkung Fühmanns ablesen: „Immer / hat der Held Angst“, 6heißt es in einem seiner Gedichte, das vorgibt, von der Weisheit der Märchen zu handeln. Die Zeile ist verräterisch. Denn die wahren Märchenhelden sind in der Regel alles andere als furchtsam. Fühmann hat hier ganz offenbar unbewusst die eigenen Empfindungen auf jene sagenhaften Gestalten projiziert, die ihn in seiner Kindheit so treulich begleiteten. Jahre später hat er diesen psychischen Mechanismus selbst beschrieben: „Es ist höchste Zeit, daß ich einen Satz berichtige: ‚Immer hat der Held Angst‘. Er steht in einem meiner Märchengedichte, und ich habe hier einen Zug eines rumänischen Drachenkampfmärchens unzulässig verallgemeinert … Dieser Zug hatte mich überwältigt; er war eben das, was ich im Märchen suchte, und ich habe, ihn aufgreifend, gehofft, daß er sich in andern Märchen bestätigen würde. Er konnte es nicht; im Märchen haben die Helden sonst eben nie Angst […]“. 7
Diese allgegenwärtige Angst, dieses Gefühl, ungeschützt und bedroht zu sein, dürfte Fühmanns anerzogenen Mangel an innerer Unabhängigkeit verstärkt haben. Immer wieder suchte er Zuflucht und Orientierung bei den anerkannten gesellschaftlichen Autoritäten. Die erste Station auf jenem langen Weg der Unselbstständigkeit war die Kirche. Aufgewachsen unter dem Einfluss der Mutter, einer inbrünstigen Katholikin, entwickelte er eine einfältige, kindliche Gläubigkeit, die jenen „frommen Legenden“ entsprach, „wie sie mir meine Mutter erzählt, Legenden, die Ur-Vertrautes sagten, das mit dem Wahren zusammenfiel: Geborgensein in Sinn und Ordnung, Gerechtigkeit von Lohn und Strafe, das Vernünftig-Schöne des Guten und die Abscheulichkeit des Bösen, das immer von irgendwo außen kam“. 8
Kein Wunder also, dass er es schließlich als Auszeichnung empfand, nach der Grundschulzeit von dem Kalksburger Jesuitenkonvikt aufgenommen zu werden. Die vier Jahre, die er dort verbrachte, sind nicht ohne Folgen für sein Denken und seine literarische Arbeit geblieben, wie sich an seinen Nacherzählungen alttestamentarischer Mythen und auch an seinem Essay über Meine Bibel ablesen lässt. Doch das strenge Reglement des Internats zeitigte bei dem Zögling Franz ganz andere als die erwünschten Folgen: „Als naiv-frommes, tiefreligiöses, gottesfürchtiges Kind bin ich da hineingegangen, und als überzeugter Atheist bin ich nach vier Jahren von dort weggelaufen.“ 9
Diese Erinnerung Fühmanns ist durch die historisch überprüfbaren Fakten nicht ganz gedeckt. Nach den Unterlagen des Konvikts kehrte er „nach Weihnachten 1935 nicht mehr zurück“ in das Internat, wie sein Biograf Gunnar Decker feststellte. 10Vermutlich wurde er vom Vater aus finanziellen Gründen abgemeldet, ist also nicht aus der Schule geflohen, sondern von den Eltern auf ein anderes Internat in Reichenberg, heute Liberec, geschickt worden.
Zurückgekehrt in seine Heimat, schloss sich Fühmann – sicherlich mit dem Beifall seines Vaters – einer Jugendorganisation der faschistischen Sudetendeutschen Partei an, die den harmlos klingenden Namen Deutscher Turnverein trug. Später dann, nach der Besetzung des Sudetenlandes durch das Deutsche Reich 1938, trat er mit nur 16 Jahren in den Reitersturm der SA ein und besuchte das Gymnasium fortan in „Stiefeln und Braunhemd“. 11Die Eile, mit der er das christliche Weltbild gegen das nationalsozialistische eintauschte, lässt erkennen, wie schwer es ihm damals gefallen sein muss, ohne einen straff geordneten Orientierungsrahmen, ohne eine ideologische Führerfigur auszukommen. Während er zu dieser Zeit – wie mitunter in den Kindheitsgeschichten anklingt – beträchtliche soziale oder sogar rassische Arroganz an den Tag legte, war und blieb es um sein persönliches Selbstbewusstsein schlecht bestellt. Erst die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, einer Glaubensgemeinschaft, verlieh ihm das notwendige Maß psychischer Sicherheit – eine Anhängigkeit, die ihn zum Opfer politischer Demagogen prädestinierte.
Читать дальше