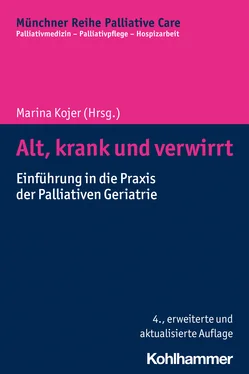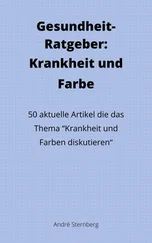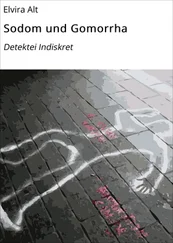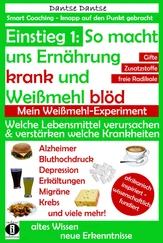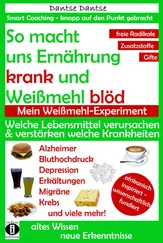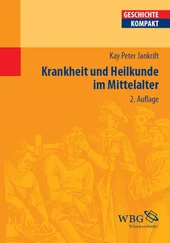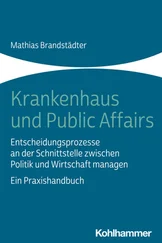Im Laufe der Zeit wurde mir immer klarer: Wir werden unsere Arbeit nur dann als sinnvoll und erfüllend erleben, wenn sie den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen, die wir betreuen, gerecht wird. Solange wir uns damit begnügen, uns allgemein gängige Berufsziele zu stecken (ordentliche Pflege, moderne medizinische Behandlung, Mobilisation um jeden Preis), wird uns das große Unbehagen nie verlassen, wir werden weiter jeden Tag frustriert nach Hause gehen. Das Individuum selbst mit seinen ganz besonderen, einmaligen und einzigartigen Nöten, Wünschen und Bedürfnissen muss unser Auftraggeber sein. Seine Lebensqualität ist das einzig sinnvolle Maß für unsere Leistung. Es geht also nicht primär um »Ziele der Institution« oder um das, was heute in der Geriatrie à la mode ist – es geht in erster Linie immer um Leben und Sterben von Individuen! Wenn wir Helferinnen sein wollen, muss es unsere vornehmste Aufgabe sein, die Menschen, die wir betreuen zu verstehen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen, ihr Vertrauen zu erwerben und ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Erst dann werden wir unsere fachliche Kompetenz so einsetzen können, dass ihnen damit tatsächlich geholfen ist. Professionalität darf gerade in der Geriatrie nicht dort enden, wo Heilung oder wesentliche Besserung nicht mehr möglich sind. Unser Auftrag gilt auch dann, ja, er gilt dann mehr denn je! Je kränker und hilfloser unsere Patientinnen werden, desto mehr brauchen sie uns. Nicht der Mensch, den wir nach kurzer Behandlungszeit gesund und vergnügt nach Hause entlassen, braucht die fachkundigsten Helferinnen, die besten und einfühlsamsten Ärztinnen und Pflegepersonen. Es sind die Leidenden am Ende ihres Weges, die sich selbst nicht mehr helfen können und zu schwach sind, um nach Hilfe zu schreien, die uns am dringendsten brauchen. Sie sind voll und ganz auf Menschlichkeit und Können ihrer Betreuerinnen angewiesen. Heute wissen wir längst, dass Pflegende und Ärztinnen noch sehr viel tun können, wenn der Tod näher rückt. Zur Zeit der 1. Auflage dieses Buches waren solche Gedanken im Pflegeheim fast schon revolutionär und lösten bei sehr vielen – selbst bei etlichen Kolleginnen – nur ein befremdetes Kopfschütteln aus.
Schließlich zeigte sich für mich, nach einer langen, von Enttäuschung, Zweifeln, Unsicherheit und Traurigkeit geprägten Zeit, das Licht am Ende des Tunnels. Ich fand meinen persönlichen Weg: Ich hörte auf, mich »anders« oder gar »besser« zu fühlen als die Menschen, die ich betreute. Stattdessen öffnete ich mein Herz ganz weit und ließ mich vom Leid meiner Patientinnen, vom Leid »der Menschen auf der anderen Seite«, anrühren. Ich nahm jetzt immer deutlicher wahr, dass jede von ihnen ein »Ich« besitzt, genauso wie ich selbst. Immer häufiger stellte ich mir, wenn ich an einem Bett stand, die Frage: »Wie würde ich mich fühlen, wenn ich an ihrer Stelle wäre?« Ich musste auch lernen, meinen Schmerz und meine Hilflosigkeit zuzulassen, wenn ich nicht helfen konnte. Ich musste lernen, auch das nicht zu übersehen, zu beschönigen oder wegzuschieben, was sich im Augenblick nicht verändern ließ. Diese neue Einstellung führte mich ohne viele Umwege zu den eigentlichen Bedürfnissen meiner Patientinnen. Damit war mein Weg zur Schmerztherapie und in die Palliative Care vorgezeichnet (Kojer 2007). Ich bin ihn viele Jahre gegangen und stehe in vieler Beziehung noch immer am Anfang.
Bald stieß ich auf eine Barriere, die ich zwar bereits zu Anfang gesehen hatte, die aber während meiner Orientierungsphase in den Hintergrund getreten war: Auch wenn ich selbst überzeugt war, den richtigen Weg gefunden zu haben – ich konnte doch nur in Einzelfällen helfen. Verändern konnte ich allein nichts. Bravourleistungen oder Solodarbietungen kompetenter und engagierter Ärztinnen und Pflegenden reichen allein niemals aus, um Menschen am Lebensende zu helfen. Es gibt in der Medizin wenige Tummelplätze für Solistinnen; Palliative Care ist jedenfalls bestimmt keiner von ihnen. Für Behandlung, Betreuung und Begleitung Schwerkranker und Sterbender ist eine tragfähige Betreuungskette aller Helfenden unverzichtbar. Jedes Teammitglied muss ein wertvolles Glied dieser Betreuungskette sein und an seiner Stelle dazu beitragen, dass diese auch unter Belastung nicht reißt. Ich finde daher das Wort »Palliativmedizin« irreführend und bin überzeugt davon, dass der umfassendere Begriff Palliative Care das Wesentliche – die unverzichtbare Leistung eines ganzen Teams – viel genauer umreißt.
Aber auch wenn die am Krankenbett Tätigen ein gemeinsames Verständnis im Sinne der Palliative Care erreicht haben, müssen noch immer die Institution und ihre Träger dafür gewonnen werden, ehe die Weichen tatsächlich umgestellt werden können.
Theoretische Erkenntnisse sind eine schöne Sache, aber sie machen den, der sie hat, nicht für lange froh! Wie sollte ich meine fast 150 multiprofessionellen Mitarbeiterinnen für meine Vorstellungen begeistern?
Als ich 1989 die Leitung der 1. Medizinischen Abteilung im Geriatriezentrum am Wienerwald (GZW) übernahm, erwartete mich dort Susanne Pirker, die sehr ähnlich dachte wie ich und als langjährige Oberärztin bereits einiges bewegt hatte. Von nun an versuchten wir gemeinsam, andere auf unseren Weg mitzunehmen. Konnte uns das überhaupt glücken? Und wenn ja, würde die Institution jemals bereit sein, Rücksicht auf Menschen zu nehmen, mit denen »kein Staat zu machen ist«? Würde sie bereit sein, beträchtliche (vor allem personelle) Ressourcen in diese »unattraktive« Zielgruppe zu investieren?
Zu diesem Zeitpunkt kam uns das Glück zu Hilfe: 1993 wurde die Idee geboren, im Rahmen des GZW ein Hospiz für Krebspatientinnen ab dem 19. Lebensjahr zu eröffnen. Im Zuge der immer konkreter werdenden Planungen stellte sich heraus, dass eine solche Initiative in einer Pflegeeinrichtung der Gemeinde Wien nur dann politisch korrekt ist, wenn zugleich auch etwas für die Betreuung schwerkranker und sterbender geriatrischer Patientinnen getan wird. 1995 begann der vom Gemeinderat der Stadt Wien beschlossene, für zwei Jahre anberaumte »Modellversuch Sterbebegleitung« (Kojer 1997), in dessen Rahmen das Hospiz seinen Probebetrieb aufnahm. Gleichzeitig sollte auch »etwas geschehen«, um Behandlung, Pflege und Begleitung am Lebensende alter Menschen zu verbessern. Das GZW begann als erstes Pflegeheim, sich ernsthaft Gedanken über die Qualität des Sterbens seiner Patientinnen zu machen.
Mir wurde von der Direktion die Leitung des gesamten Modellversuchs übertragen. Am meisten Kopfzerbrechen machte mir dabei die Entwicklung brauchbarer Strategien für den geriatrischen Bereich. Erwähnenswerte Ressourcen waren dafür nicht vorgesehen. War von »oben« nicht mehr als ein »geriatrisches Feigenblatt« geplant? In den Mitgliedern der kleinen, aus verschiedenen Berufsgruppen zusammensetzten Projektgruppe fanden Susanne Pirker und ich Gleichgesinnte, die ebenso wie wir fest entschlossen waren, Tabus anzugreifen und alte, verkrustete Strukturen infrage zu stellen. In den zwei Jahren gelang es uns tatsächlich, Weichen zu stellen und Veränderungen in Gang zu setzen, die seither nie mehr ganz zum Stillstand gekommen sind.
Eine der Initiativen des Modellversuchs bestand in der Etablierung von drei »Modellstationen«. Die drei Teams wurden eigens geschult und während des gesamten Zeitraums psychologisch unterstützt. Unser Ziel war zu überprüfen, ob diese Maßnahmen auch ohne Strukturänderungen (weder mehr Personal noch weniger Patientinnen pro Zimmer) die Qualität der Betreuung nachweislich verbessern würden. Eine Station meiner Abteilung bewarb sich darum mitzumachen. Unter der Leitung von Susanne Pirker und Michaela Zsifkovics entdeckte das Team in dieser Zeit seine Liebe zu schwerkranken und sterbenden alten Menschen. Nach Beendigung des Modellversuchs entwickelte sich die Station selbstständig und gezielt in die eingeschlagene Richtung weiter; die »Modellstation« ging in das Projekt »Sterbebegleitung = Lebensbegleitung« über. Susanne Pirker und ich waren nicht mehr allein mit unseren Vorstellungen: Zumindest auf eine unserer sechs Stationen war der Funke übergesprungen.
Читать дальше