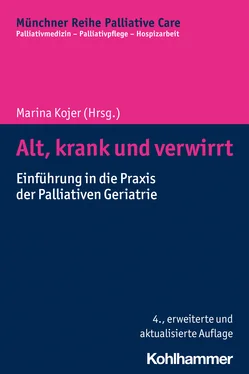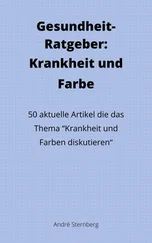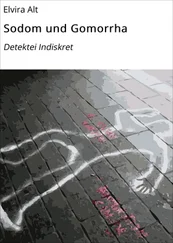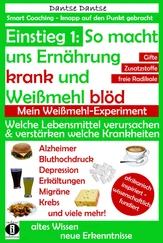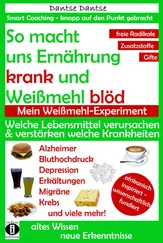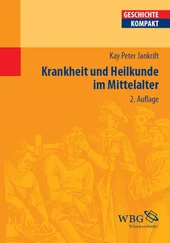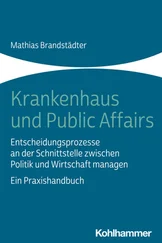Das größte Pflegeheim Europas war damals in vieler Hinsicht ein Aufbewahrungsort für anderwärts nicht mehr tragbare alte Menschen. Im Gegensatz zu den meisten solcher Institutionen beschäftigte es eine große Zahl angestellter Ärztinnen. Sie betreuten 3.000 Langzeitpatientinnen rund um die Uhr. Sie behandelten allfällige akute Krankheiten und führten, da sie im Allgemeinen nur wenig Zeit mit ihren Patientinnen verbrachten, darüber hinaus ein ziemlich bequemes Leben. Die Pflegenden arbeiteten intensiv, die meisten Tätigkeiten dienten allerdings der Aufrechterhaltung der Reinlichkeit. Einige Schwestern, gütige, mütterliche Frauen, suchten aufrichtig nach einem Weg zu den alten Menschen, ein paar schlecht oder gar nicht ausgebildete Gutwillige taten freundlich, was von ihnen verlangt wurde, die meisten anderen erledigten einfach ihren Job. Eine Zeitlang überlegte ich ernsthaft, ob ich mich nicht nach einem anderen Arbeitsplatz umsehen sollte.
Meine Ratlosigkeit angesichts dieser bedrückenden Gegenwart machte mich zu Beginn fast aktionsunfähig. Ich war enttäuscht – enttäuscht vom Alltag des Pflegeheims (ich hatte es mir ganz anders vorgestellt), enttäuscht von den Patientinnen (sie »wollten« mich gar nicht), enttäuscht von mir selbst. Da ich mich von Kindheit an zu alten Menschen besonders hingezogen gefühlt hatte, hatte ich mich bewusst für eine Arbeit in der Geriatrie entschieden. Ich war mit vielen unrealistischen Ideen und Plänen hierhergekommen, doch diese idealistischen Vorstellungen verloren angesichts ernüchternder Tatsachen rasch ihren Glanz.
Ich war gekommen, um mich als Ärztin und als Mensch für alte Menschen einzusetzen. Ich wollte nicht nur ihre Krankheiten behandeln, ich wollte sie als ganze Menschen wahrnehmen, mich ihnen zuwenden, ihr Vertrauen und ihre Zuneigung gewinnen und mit ihnen über ihr Leben sprechen. Meine Patientinnen sollten das Pflegeheim als zweite Heimat erleben und Freude am Leben haben. Die Realität schaute anders aus. Wenn ich zurückdenke, tauchen viele Bilder vor mir auf, Bilder, die sich – wenn auch mit unterschiedlichen Gesichtern, Körpern und Stimmen – im Laufe der Jahre noch oft wiederholten. Erst in den letzten zehn Jahren meiner Tätigkeit als ärztliche Leiterin einer Abteilung kamen seltener neue, negative Bilder hinzu.
Der demenzkranke, alte Mann ist mit einem zusammengerollten Leintuch an seinem Stuhl festgebunden. Wird das Leintuch entfernt, versucht er sogleich aufzustehen und fällt hin. Er könnte sich dabei verletzen, davor muss er »geschützt« werden. Es »geht nicht anders«. Er sitzt regungslos, den Kopf nach vorne geneigt, mit resigniert geschlossenen Augen. Sein unbewegtes Gesicht ist eine Maske der Trostlosigkeit. Er wirkt auf mich wie ein angeketteter Strafgefangener. Ich spreche ihn an – sein Gesicht bleibt regungslos, er hebt seinen Kopf nicht.
Urlaubszeit, Krankenstände, Personalnot, Zeitnot. Ich gehe im Nachtdienst zur Zeit der Abendarbeit über den Gang. Eine Patientin schreit, ihre Stimme ist voller Angst: »Mama, Mama hilf mir!« Darauf die Stimme der Pflegenden, ungeduldig, zornig und laut: »Sei ruhig! Die Mama kann dir jetzt auch nicht helfen!« Es ist eine altgediente, angesehene Schwester, und ich bin erst kurz im Haus. Ich zwinge mich dazu, in das Zimmer zu gehen: »Müssen Sie so schreien? Die Frau fürchtet sich doch!« Die Pflegekraft schaut nur kurz auf: »Frau Doktor, wenn man zu zweit 40 Patientinnen fertig machen muss, kann man sich den Luxus nicht leisten, jede Einzelne mit Glacéhandschuhen anzufassen und zu streicheln!«
Ich stehe am Bett einer Sterbenden. Ich bin sicher, dass sie nur mehr kurz zu leben hat. Ob sie in einem Tag, in drei Tagen oder in einer Woche stirbt, weiß ich freilich nicht. Ihr Herz ist schwach, sie trinkt kaum mehr, kann keine Medikamente schlucken. Ich handle, wie ich es gelernt habe: Blut abnehmen, Infusion anhängen – die Patientin ist unruhig, ihr Arm muss fixiert werden – Therapie auf Spritzen umstellen, Dauerkatheter. Als ich damit fertig bin, überfällt mich der quälende Gedanke: Habe ich wirklich geholfen oder war am Ende alles, was ich getan habe, falsch? Was ist richtig?
Viele Jahre später …
Von dem Augenblick an, in dem ich das Zimmer betrete, halten mich die Augen der hochbetagten Frau fest. Sie sitzt im Lehnstuhl. Ihr Gesicht ist von Schmerz und Erschöpfung gezeichnet. Sie ist 94 Jahre alt. Ich gehe zu ihr, sie blickt flehend, mit erhobenen Händen zu mir auf: »Frau Doktor, haben Sie Erbarmen mit mir, lassen Sie mich wieder ins Bett gehen!« Ich schäme mich. Die Pflegerin erklärt: »Frau Primaria, wir haben sie wirklich erst vor einer halben Stunde herausgesetzt. Wenigstens anderthalb Stunden muss sie sitzen bleiben, das viele Liegen tut ihr nicht gut.« Ich bitte darum, dass sie ins Bett gebracht wird.
Ich will eine sehr alte, schwerkranke Patientin zu einer Untersuchung schicken. Die Stationsleitung legt ihre Hand auf meinen Arm und schaut mich bittend an: »Wird sich durch das Untersuchungsergebnis etwas ändern? Können wir ihr den Transport, die Angst und das Warten nicht ersparen?« Ich spüre tief innen, dass sie Recht hat und verzichte auf die Untersuchung. Später weiß ich nicht mehr, ob ich damit das Richtige getan habe.
Visite. Ich betrete eines der großen Zimmer, in dem mehrere Patientinnen leben. Drei schwerkranke Patientinnen liegen im Bett, die restlichen fünf sitzen auf ihren Stühlen. Alle wirken traurig, einsam. Niemand spricht, niemand schaut auf. Ich setze mich zu einer Patientin und spreche sie an. Ihr müder Blick streift mich kurz, bleibt nicht hängen, sie versinkt wieder in ihrer Einsamkeit.
Mir fallen ein paar Zeilen aus dem Gedicht »Der Panther« von Rainer Maria Rilke ein:
Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Immer wieder denke ich nach: Wir wollen doch alle (zumindest fast alle) helfen – aber tun wir es wirklich? Freilich gibt es auch »liebe«, »pflegeleichte« Patientinnen, die uns anstrahlen, plaudern und uns ihrer Dankbarkeit und Zufriedenheit versichern. (Erst viel später finde ich heraus, dass viele von ihnen gar nicht so »lieb« sind, sondern gelernt haben, wie man sich zu verhalten hat, damit es einem im Pflegeheim halbwegs gut geht!) Aber was ist mit den vielen anderen? Sind sie, wie ich immer wieder höre, »undankbar«, »lästig«, »aggressiv« und »machen uns alles zu Fleiß«? Viele Jahre später gab Michaela Zsifkovics, Stationsleitung auf einer unserer Frauenstationen, in meiner Gegenwart einer Mitarbeiterin, die anklagend zu ihr kam, die Antwort, nach der ich damals noch vergeblich gesucht hatte: »Schau dir die hilflose und verzweifelte alte Frau doch einmal mit offenen Augen an! Wie kann sie dir etwas zu Fleiß machen?« Ich verstand einmal mehr, dass wir alle erst lernen müssen zu schauen.
Unheilbar kranke, behinderte und demenzbetroffene Hochbetagte, die ihre Ansprüche nicht mehr selbst geltend machen können, finden in den derzeitigen Betreuungseinrichtungen keine ihren besonderen Bedürfnissen entsprechende Infrastruktur vor. Mit Methoden, die sich für jüngere, weitgehend autonome Kranke eignen, lässt sich die subjektive Lebensqualität unserer Patientinnen sehr oft nicht entscheidend verbessern. Ihr Zustand erfordert, insbesondere wenn das Lebensende näher rückt, andere Denkmodelle und Zielsetzungen im Hinblick auf Diagnose, Therapie, Kommunikation, Tageseinteilung und Angehörigenbetreuung. Bisher wurden weder befriedigende Strukturen dafür geschaffen noch die am Krankenbett Tätigen so ausgebildet, dass sie über die nötige Kompetenz verfügen. Der immense und sicher weiterhin anwachsende Bedarf nach solchen Modellen wird uns immer deutlicher, je länger und intensiver wir uns mit dem Thema auseinandersetzen.
Читать дальше