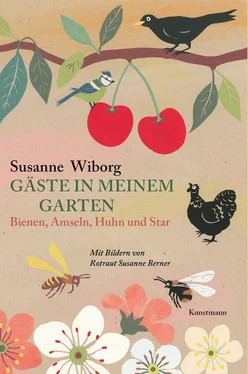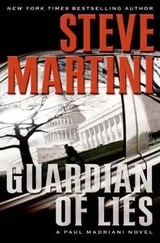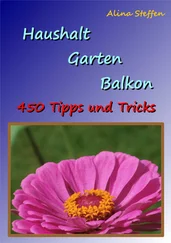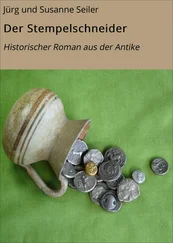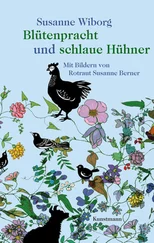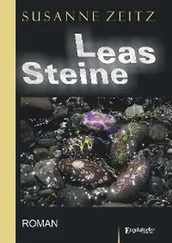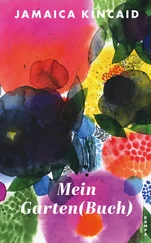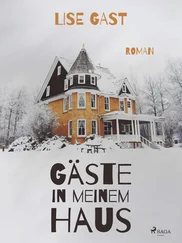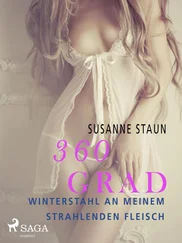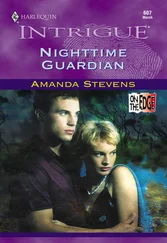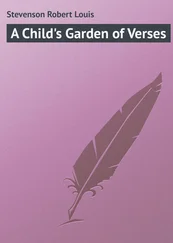Diesen Garten-Festtag wollte ich genießen wie noch nie, denn lange war meine Zuneigung zu den zierlichen botanischen Krokussen eher einseitig gewesen. Die kleinen Schwertliliengewächse erwiderten sie nicht. Aus gutem Grund: Viele von ihnen stammen ursprünglich aus warmen Gegenden, und mein bindiger, nasser Boden vertrieb sie alle. Mit einer Ausnahme: Der Elfenkrokus, ursprünglich ein Laubwaldbewohner, kommt hier prima zurecht und hat in seiner amethystfarbenen Niedlichkeit das ganze Revier erobert. Und nun schien endlich die Zeit gekommen, ihm Gesellschaft zu geben und einen Krokus-Neustart zu wagen. Unter dem großen Kirschbaum gab es, nachdem ich jahrelang das Laub, bedeckt von Kompost, dort hatte verrotten lassen, inzwischen wunderbar lockeren Humus für kleine, frühe Zwiebelpflanzen.
Außerdem waren die Gast-Bienen eingezogen, und die schätzen Krokusse ganz besonders, als eine der ersten Futterquellen des Jahres, die sie reichlich mit Pollen versorgt. So lag es nahe, ihre Interessen und meine perfekt zu kombinieren: Ich bestellte 600 botanische Krokuszwiebeln – mit bemerkenswerter Selbstbeschränkung übrigens. Früher wären es bei all den verlockenden Sorten und Farben sicher noch deutlich mehr geworden. Aber einige wirklich unfreundliche Dezembertage mit eisigem Schneeregen und reichlich Blumenzwiebeln, die dringend noch in die Erde wollten, haben mich da doch eine gewisse Beherrschung gelehrt. Auch so reichte es für einen üppigen Kragen rund um den Baum, ein perfektes Bühnenbild für den großen Auftritt der ersten Insekten der Saison.
Einen langen Winter über sah ich sie bei jedem Blick in diese Ecke schon erwartungsfroh vor mir: die Bienen und die Hummelköniginnen, die gaukelnden Zitronenfalter und vielleicht sogar das erste Pfauenauge. Doch allmählich wich die Vorfreude der Beklemmung: Es wurde nicht richtig Winter, es wurde nur furchtbar nass. Wochenlang. Genau das Wetter, das die meisten Zwiebelpflanzen wirklich hassen, alle Schimmelpilze dagegen wirklich lieben. Würden meine Krokusse das überleben, oder würden sie wegsterben wie so oft zuvor? Als sich der März näherte, umkreiste ich Tag für Tag den Kirschbaum. Tag für Tag dieselbe Enttäuschung: Nichts zu sehen, nicht eine Spitze. Würde es vielleicht – ein finsterer Verdacht, der mich nach einer Überdosis Winter aller Erfahrung zum Trotz regelmäßig beschleicht – überhaupt nicht Frühling werden? Nie? Einfach immer so weitergehen mit dem klammen Grau, das über uns zu lasten schien wie ein Fluch? Die erste Märzwoche verging, die zweite – nichts. Warum tat ich mir das an, alle Jahre wieder? Wäre es nicht besser gewesen, zur Flucht aus dem Winterfrust statt auf den Garten lieber auf eine Reise in freundlichere Gefilde zu setzen?
Und dann passierte eben doch, was sich zwar alljährlich wiederholt, was ich aber immer erst wirklich glauben kann, sobald es soweit ist: Mehrere Tage nacheinander schien die Sonne. Überall schoben sich wie im Zeitraffer dicke Spitzen aus der Erde – und da waren sie plötzlich, die bunten Krokusse! Zwar längst nicht alle sechshundert, aber doch genug für ein prachtvolles Bild: Büschel an Büschel, cremegelb, violett, lavendelfarben, blauweiß, und golden. Ein zarter, süßer Duft hing in der Luft, überall in den strahlenden, offenen Kelchen tummelten sich pollengepuderte Bienen und Hummeln, und auch die ersten Schmetterlinge waren zur Stelle. Als die überschwängliche Pracht verblüht war, hatte der Frühling endgültig gesiegt. Es ging tatsächlich alles wieder los, endlich, und doch: Inmitten dieser bunten Explosion war schon wieder etwas vorüber, für ein ganzes langes Jahr. Für einen kurzen, verrückten Moment wünschte ich sie mir zurück, diese ebenso kribbelnde wie frustrierende Vorfreude, mit der auch der längste Winter irgendwann endet. Bis jetzt jedenfalls…

Eier frisch aus dem eigenen Garten sind zwar ein kulinarischer Traum, aber: Es gibt sie nicht jederzeit in beliebiger Menge. Massenproduktion rund ums Jahr ist Sache der industriellen Legehybriden. Rassehühner wie meine Zwergwyandotten haben sich – wenn man beim Haushuhn überhaupt noch davon sprechen kann – einen halbwegs natürlichen Zyklus bewahrt: Sie legen in der hellen Saison und nehmen, sobald die Tage kürzer werden, ihre wohlverdiente Ruhepause in Anspruch. Dann wechseln sie das Gefieder und stellen das Eierlegen währenddessen komplett ein. Genau das ist der Moment, in dem ihre bedauernswerten Kolleginnen aus Wirtschaftsbetrieben entsorgt werden, denn ob Bio oder nicht: kein Betrieb kann es sich leisten, Tausende von Hennen wochenlang in die Ferien zu schicken. Meine verwöhnten Gartentiere dagegen bekommen sogar eine noch längere Pause, weil ich im Winter darauf verzichte, sie mit künstlichem Licht anzuregen. Sie dürfen mit der forcierten Höchstleistung also gleich für einige Monate aussetzen, was mir einen zusätzlichen Frühlingsspaß einbringt: Sobald die Sonne endlich wieder höher steigt, warte ich nicht nur sehnsüchtig auf das erste Schneeglöckchen, sondern ebenso auf das erste Ei der Saison. Eine deutlich geschärfte Sicht der Dinge gibt es dabei gleich dazu: Plötzlich kann ich all die alten Oster- und Frühlingsbräuche rund ums Ei wirklich verstehen. Eier sind ein mindestens ebenso mächtiges Symbol des wiederkehrenden Lebens wie Sonne und Blumen. Dazu haben sie diese magische Dimension: der ganze Neubeginn, verpackt in eine perfekte Form. In Vor-Supermarkt-Zeiten muss das wirklich immer ein kleines Wunder gewesen sein – und dazu noch eins, das nach der öden Winterkost unvergleichlich gut schmeckte.
Mit meiner Vorfreude bin ich nicht allein. Auch die Hennen scheinen zu wissen, dass der Wiedereintritt in die Berufstätigkeit ein großes Ereignis in ihrem kleinen Leben bedeutet: Waren sie über Winter eher zurückgezogen, werden sie sie jetzt deutlich lebhafter und schmücken sich, wie es die Wildvögel zur Fortpflanzungszeit auch tun: Das frisch gewechselte, makellose Gefieder glänzt in der Frühlingssonne, Kamm und Kehllappen färben sich leuchtend rot. Besonders niedlich ist diese Verwandlung, wenn es auch noch ganz junge Hennen sind, die sich auf den ersten Legebeginn vorbereiten. Hier waren es diesmal die Neuzugänge Ida und Irmchen, die das Erwachsenwerden geradezu zelebrierten: Sie unterhielten sich lebhaft wie kichernde Teenager und begannen, im Team alle möglichen Brutplätze zu erkunden. Unmögliche auch: Klein-Irmchen führte die Suche nach dem idealen Ort irgendwann hoch ins Schuppenregal. Als sie sich dort probehalber drehte, begannen die gestapelten kleinen Plastikblumentöpfe bedrohlich zu wackeln. Irmchen flatterte eilig in Sicherheit, gefolgt von einer ganzen Topfkaskade, die dafür die unten wartende Ida voll erwischte. Mit einem doppelten, entsetzten »BAAAAK!« stoben die beiden davon wie kleine bunte Raketen – einer dieser Cartoon-Momente, für die man das Federvieh einfach lieben muss. Schließlich saßen sie dann aber doch in den richtigen Legenestern, formten mit Hin- und Herdrehen eine bequeme Mulde, zupften am Stroh herum und warfen sich tagelang mit – es lässt sich nicht anders sagen – wichtiger Miene Halme über den Rücken. Dann waren sie da, die allerersten Eier: cremeweiß von Ida, bräunlich von Irmchen. Ein derart großer Moment muss akustisch gewürdigt werden, das finden nicht nur die Jüngsten. Die älteren Hennen, halten das genauso, sobald sie mit dem Legen wieder einsetzen: Das ganze Viertel darf an ihrer Leistung Anteil nehmen. Beim großen Gegacker geben die Mädels wirklich alles, und das gern mal im Chor.
Sie sind ja auch entsprechend fleißig. Im Mai liegen täglich so viele warme, handschmeichelnd glatte Eier in den Strohnestern, dass ich mir wie eine stolze urbane Selbstversorgerin vorkommen kann. Nur: Inzwischen wohnen hier elf tüchtige Hennen, und schnell quillt der Kühlschrank über. Genau deshalb schwingen sich viele Hühnerbesitzer um diese Jahreszeit zu ganz unerwarteter kulinarischer Kreativität auf: der Segen will frisch verbraucht sein, dann schmeckt er am besten. Zum Glück gibt es gerade Spargel und frischen Schnittlauch für zahlreiche köstliche Omeletts, und es gibt ganz neue Küchenerfahrungen: Kuchenteig von einem Goldgelb, das in seiner cremigen Intensität beinahe wie gefärbt aussieht. Dabei verdanken die Eidotter ihre intensive Farbe allein dem frischen Gartengrün. Eine dankbare Inspirationsquelle sind auch Urgroßmutters Kochbücher, in denen die Rezepte regelmäßig so beginnen: »Man nehme zwei Dutzend Eigelb und ein Pfund Butter…« Um eine Kuh allerdings möchte ich meine Menagerie dann doch nicht erweitern, die Hühner sind fleißig genug. So kriegen dann eben die Nachbarn ihren Teil von der großen Ausbeute ab. Was nur gerecht ist: das Gegacker teilen sie schließlich auch!
Читать дальше