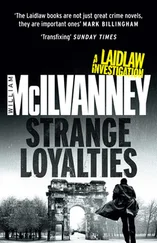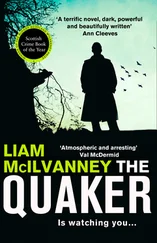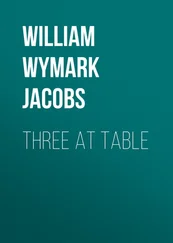Brian hatte recht. Mein Leben war ein entsetzliches Durcheinander. Miguel de Unamuno hatte etwas geschrieben, das auf mich zutraf. Wenn es mir nur wieder eingefallen wäre. Ich las eine ganze Menge Philosophie, fast schon fieberhaft, wie einer der kurz vor dem Eintreffen des Henkers noch verzweifelt die versteckte Eisensäge sucht. Unamuno hatte die Behauptung aufgestellt: Wenn ein Mensch das Gefühl für seine eigene Kontinuität verliert, dann war’s das. Er hat’s verkackt und ist im Arsch. Tut mir leid, Miguel, wenn das nicht korrekt zitiert war.
So ging es mir. Ich hatte das Gefühl für meine Kontinuität verloren. Ich improvisierte mich von einem Tag auf den anderen. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Das Leben, das ich zu konstruieren geglaubt hatte, war in sich zusammengefallen. Zum Beispiel meine Familie. Ich hatte sie immer für das Zentrum meines Lebens gehalten. Jetzt war ich unwiderruflich von Ena getrennt und sah meine Kinder nur noch nach terminlicher Absprache. Meine Beziehung zu Jan befand sich in einem sinnlichen Schwebezustand – ein frei dahintreibendes Bett, das in keinerlei sozialer Struktur verankert war. Mir war nicht klar, was ich ihr über den Liebesakt hinaus zu bieten hatte. Ich lebte von einem Job, an dem ich täglich zweifelte. Und gerade als ich glaubte unterzugehen, und jede noch so kleine Bestätigung der Sinnhaftigkeit des Lebens hätte gebrauchen können, war mein Bruder, der in meinen schlimmsten Zeiten wichtiger für mich gewesen war als ich selbst, vor ein Auto gelaufen. Zufall. Oder nicht?
Irgendetwas in mir musste glauben, dass es keiner war. Ich wollte aber auch nicht behaupten, er hätte sich selbst umgebracht. Also was wollte ich behaupten? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich Schuldgefühle. Jedes Mal, wenn eine von mir geliebte Person starb, hatte ich mich schuldig gefühlt. Ich hatte nie genug Zeit mit demjenigen verbracht, ihn nie genug geschätzt, als er noch am Leben war, ihm nie genug gegeben.
Aber die Schuld, so glaubte ich seltsamerweise, lag nicht nur bei mir.
In dieser Hinsicht war ich seit jeher großzügig. Ich wollte immer so viele Menschen wie möglich, einschließlich mich selbst, in jeden einzelnen Fall verstricken, in dem ich zu ermitteln hatte. Wenn es nach mir ginge, säße die gesamte Weltbevölkerung auf der Anklage bank. Wir würden alle aussagen, unsere traurigen Geschichten erzäh len. Und dann gäbe es einen massenhaften Freispruch, wir würden alle fortgehen und es noch einmal versuchen. (Aber verraten Sie meinem Vorgesetzten beim Crime Squad nicht, dass ich das gesagt habe.)
Scott, mein toter Bruder, war inzwischen zum Zentrum dieses manischen Gefühls geworden, das ich so lange unterdrückt hatte. Ich wollte unbedingt, dass sein Tod mehr bedeutete, als es den Anschein hatte. Wenn der Reichtum seines Lebens am Nummernschild eines zufällig herannahenden Wagens enden konnte und es das gewesen war, dann war ich bereit, den Laden meiner Überzeugungen dichtzumachen und mein Verständnis von Moral am Ausgang abzugeben. Die Welt war ein Bingo-Stand.
Aber das wollte ich nicht. Ich brauchte Scott im Tod genauso wie im Leben. Ich brauchte ein sinnhaftes Wiedersehen zwischen uns.
Als ich sah, dass Brian in der Tür stand und mich beobachtete, hörte ich auf so zu tun, als würde ich das Badezimmer aufräumen. Er tarnte den Überwachungsversuch mit Konversation.
»Wie soll ich was zu essen machen?«, fragte er. »Womit denn, bitte schön? Dein Kühlschrank könnte in einem Schaufenster stehen. Es ist absolut nichts drin. Was soll ich kochen? Suppe aus Fenstervorhängen? Ich hab den Teekessel aufgesetzt. Wenigstens Wasser hast du noch, soweit ich gesehen habe.«
»Ich führe ein genügsames Leben, Brian.«
»Genügsam? Du bist eine Ein-Mann-Hungerkatastrophe.«
»Eier«, sagte ich.
»Stimmt. Vier Eier in einer Plastikpackung. Das ist alles.«
»Dann koch sie. Und mach Toast. Für jeden zwei, dazu Kaffee.«
»Dein Brot hat Ähnlichkeit mit Badezimmerfliesen.«
»Getoastet merkt man’s gar nicht.«
»Okay, Egon.«
Während er in der Küche ein Feinschmeckerfrühstück zauberte, ging ich ins Schlafzimmer. Ich zog mich an und legte meine schwarze Lederjacke aufs Bett – ein vielseitiges Kleidungsstück, auf einer Cocktailparty war man damit ebenso gut angezogen wie auf der Hunderennbahn. Ich wusste nicht, wohin es mich verschlagen würde. Im Schrank fand ich die Reisetasche. Was sollte ich reintun, das war die Frage. Wenn’s ums Packen geht, bin ich ein hoffnungsloser Fall. Normalerweise schiebe ich es bis zur allerletzten Minute auf, nur um eine Ausrede zu haben, falls es schiefgeht.
Ich wollte circa eine Woche weg. Im Schrank hingen fünf saubere Hemden, die ich aufgehängt hatte, weil ich kein Bügeleisen besaß. Gott segne den Trockner. Aber es bedeutete, dass ich mir jetzt überlegen musste, wie ich sie zusammenlegte. Erst mal alle zuknöpfen, dann mit der Vorderseite nach unten aufs Bett legen, jeweils an der Schulter einschlagen, die Ärmel umklappen, den Rest zusammenfalten, und schon stand man vor einem tadellos ordentlichen Objekt. (Rubrik Privates: Haushaltshilfe gesucht, alle Tätigkeiten.)
Fünf Hemden müssten reichen, außerdem das, welches ich anhatte, jedenfalls wenn ich noch zwei Pullover einsteckte, mit denen ich Schmutzränder am Kragen verstecken konnte, sollte sich dies als notwendig erweisen. Ich packte alles ein, wovon ich dachte, dass ich es gebrauchen könnte, und hielt mich dabei an Laidlaws unfehlbare Packerregel: vom Kopf bis zu den Füßen, alles zwei Mal überprüfen. Ein zweites Paar Schuhe hatte ich vergessen. Ich packte sie ein. Okay. Schuhe. Sieben Paar Socken. Sieben Unterhosen, ungebügelt. Fünf Hemden. Zwei T-Shirts für unter den Rollkragenpullover, falls sich herausstellen sollte, dass die Hemden am zweiten Tag nicht mehr tragbar waren. Zwei Krawatten, sollte förmliche Garderobe gefragt sein. Zwei Extrahosen, geschickt eingerollt, um Knitterfalten zu vermeiden. Ein Jackett.
Der Kulturbeutel. Ich ging ins Badezimmer und steckte alles, was ich brauchte, hinein, kam damit zurück und packte ihn ein. Die Reisetasche sah nicht gut aus. Sie beulte sich tumorartig an mehreren Stellen aus. Aber der Reißverschluss ging zu. Ich fand meine Migränetabletten und stopfte sie in eine der Seitentaschen. Sankt Georg war bereit.
Brian auch. Wir setzten uns an den Tisch am Fenster und frühstückten. Sah aus, als sollte es ein schöner Tag werden. Ich hatte keinen Regenmantel eingepackt.
»Der Toast ist anstrengend«, behauptete Brian. »So was sollte man nur in Gruppen essen. Für einen ist das zu viel, man braucht eine ganze Kaumannschaft.«
»Ich mag ihn so. Man hat mehr davon, schiebt sich sein Essen nicht einfach in den Mund und schluckt es herunter. Der Toast fordert Aufmerksamkeit.«
Aber ich wusste, unser varietéreifes Geplänkel ließ sich nicht ewig fortsetzen. Die Darsteller der Hauptvorstellung warteten schon hinter den Kulissen.
»Jack, was hoffst du zu beweisen?«
»Was ich damit beweisen kann.«
»Ganz toll. Komm schon, Jack. Scott ist tot. Er wurde überfahren. Er war betrunken. Gibst du dem Fahrer die Schuld?«
»Natürlich gebe ich nicht dem Fahrer die Schuld, Brian, werd endlich erwachsen. Wieso sollte ich dem Fahrer die Schuld geben?«
»Worum geht es dir dann? Willst du den Verkehr verklagen?«
»Ich will einfach dahinterkommen. In meiner Freizeit. Wem schade ich damit?«
»Dir selbst, würde ich sagen.«
»Egal. Was hast du heute vor?«, fragte ich und wechselte den Kurs.
»Mit Bob Lilley arbeiten. Sein Partner hat auch gerade frei. Aber nicht aus Gründen der Unzurechnungsfähigkeit.«
»Aha. Steht was an?«
»Nicht weit vom Fluss wurde eine Leiche gefunden. Gegenüber der Rotunda. Noch nicht identifiziert. Mit einem Strick um den Hals.«
Читать дальше