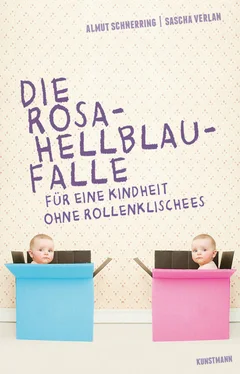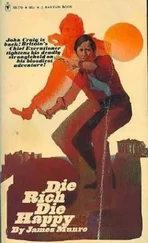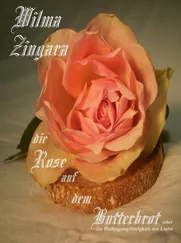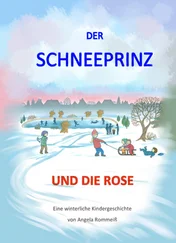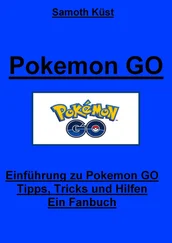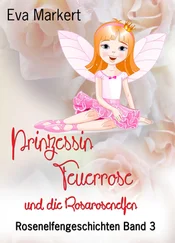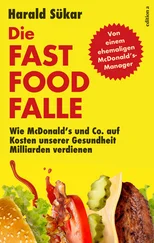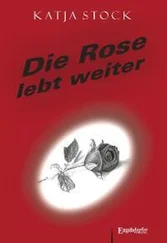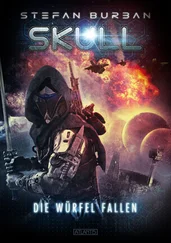»Wie süüüß!«, sagen oder fühlen Menschen, wenn ein Säugling oder Kleinkind unter den Decken eines Kinderwagens strampelt und lustige Laute ausprobiert. Und das ist auch gut so. Denn wer klein und niedlich ist, bekommt automatisch Schutz. Das Kindchenschema funktioniert zum Glück auch ohne Rosa. Deshalb gibt es nicht wirklich Anlass, es bei Mädchen durch Rüschenkleidchen und Blümchen zu verstärken. Warum soll die eine Hälfte noch süßer und niedlicher sein als die andere? Brauchen Mädchen etwa mehr Schutz und Zuwendung als niedliche, stupsnasige Jungs? Offenbar sind viele Eltern und Großeltern dieser Ansicht. Deshalb werden weibliche Säuglinge auch prompt fester angefasst und mit tieferer Stimme angesprochen, kaum dass sie hellblaue Kleidung tragen und für einen Jungen gehalten werden. Und andersherum gehen die Stimmen bei einem Jungen, der in Rosa gekleidet wird, nach oben. Weint ein Junge, nehmen Erwachsene an, dass er wütend ist, bei einem Mädchen vermuten sie dagegen eher Angst. Es sind die sogenannten ›Baby-X-Studien‹ 14, die belegen, wie anders Erwachsene auf ein Baby reagieren, abhängig davon, ob sie es für einen Jungen oder für ein Mädchen halten. Der Begriff geht zurück auf zwei Studien der Psychologin Phyllis A. Katz, die die unterschiedliche Spielzeugwahl (Puppe, Ball oder Ring) Erwachsener beobachtete, wenn ihnen ein Baby in gelbem Strampelanzug als Mary beziehungsweise als Johnny vorgestellt wurde. Ein und dasselbe Verhalten wird also unterschiedlich gewertet, weil wir das, was wir sehen, abgleichen mit dem, was wir als typisch Mädchen beziehungsweise typisch Junge tief im Unterbewusstsein gespeichert haben. In einem Experiment, das die motorischen Fähigkeiten von Krabbelkindern untersuchte, zeigte sich, dass Eltern dazu neigen, Jungen zu überschätzen, Mädchen dagegen zu unterschätzen, obwohl objektiv keine Unterschiede in den Fähigkeiten der Jungen und Mädchen vorhanden waren 15.
Sitzt unser angebliches Wissen über Jungen und Mädchen nicht zu tief, können wir in solchen Situationen überhaupt aus unserer Haut? Wir haben nicht darauf geachtet, ob wir mit unseren Töchtern mehr gesprochen haben als mit unserem Sohn. Ob wir mit ihr einen körperlicheren Umgang gepflegt und ihm schon im Krabbelalter einen größeren Bewegungsradius zugestanden haben. Aber im Nachhinein irritiert uns schon, dass unsere älteste Tochter Mika nie gekrabbelt ist und sich dafür ausgiebig und feinstmotorisch auf ihrer Decke sitzend mit Kleinzeug beschäftigt hat. Sie hat unsere CD- und Bücherregale ausgeräumt, Schubladen und Fächer in der Küche neu sortiert, alles ohne Krabbeln. Kleiner Bewegungsradius, typisch Mädchen? Oder typisch für Eltern in der Genderfalle? Oder gar Familienerbe über die Geschlechtergrenzen hinweg, denn meiner Mutter fiel gleich wieder ein, dass ich ja auch nicht gekrabbelt sei. Als Mika laufen konnte, sind wir dann zwar über Stock und Stein durch die Bäche und Schluchten unserer Umgebung gewandert, ob das aber als Ausgleich ausreicht? Immerhin waren wir davon überzeugt, dass, was auch immer unsere Kinder von sich aus mitbringen mögen, sich Charakter, Interessen und Eigenschaften erst im täglichen Miteinander entwickeln, dass wir und unsere Kinder nicht determiniert sind, sondern uns immer weiter entwickeln können. Eltern verstärken nämlich vor allem dann das geschlechtstypische Verhalten ihrer Kinder, wenn sie davon ausgehen, es sei angeboren, erklärt Tim Rohrmann, Leiter des Instituts für Pädagogik und Psychologie und Experte auf dem Gebiet der geschlechterbewussten Pädagogik. 16
»Ist doch klar, dass es da Unterschiede gibt«, erklärte mir neulich ein Vater. »Schau, das zeigt sich doch allein schon am Testosteron.« Ich nicke und bedanke mich, dass Mika zum Essen bleiben durfte. Beim Schuheanziehen zwischen Tür und Angel kommt kein Argument an gegen das schlagkräftige Testosteron. Es kann bei Frauen und Männern gemessen werden, doch weil es ein Sexualhormon ist und bei Männern in höherer Konzentration vorkommt, weil es die Entwicklung der männlichen Geschlechtsorgane bewirkt, gilt es in den verschiedenen Alltagstheorien als »das männliche Hormon«. Mit Stichwörtern wie Aggressivität, Muskeln, räumlichem Denken und der Vorliebe für Fleisch werden dann meist in der nachfolgenden Erklärung die Unterschiede dargelegt, die sich angeblich bereits im Mutterleib nachweisen lassen. Doch beim Menschen wurden die meisten Versuche mit älteren Kindern oder Erwachsenen gemacht, sodass genauso die Erfahrung und das Gelernte Grund sein könnten für unterschiedliche Ergebnisse im räumlichen Denken. Immerhin zeigten Experimente mit Ratten, dass ein erhöhter Testosteronwert die Tiere aggressiver macht und ihnen außerdem ermöglicht, sich schneller in einem Labyrinth zurechtzufinden. Doch Testosteronwerte werden bei Menschen meistens im Blut oder im Speichel gemessen, dabei wäre der Gehalt im Gehirn wichtig, um relevante Aussagen treffen zu können. Und wenn das Verhalten von Probanden mit ihrem Testosteronspiegel verglichen wird, ist damit die Frage nach Ursache und Wirkung immer noch nicht beantwortet: Das Testosteron beeinflusst nicht nur das Verhalten, sondern das Verhalten umgekehrt auch den Hormonspiegel 17. Trotzdem erklären Zeitungsartikel mit dem »höheren fötalen Testosteronwert« die besseren mathematischen Fähigkeiten von Achtklässlern, Pausenrangeleien gegenüber Puppenspiel sowie die Vorliebe für Fleisch statt Salat. Populärwissenschaftliche Bücher übers Einparken und Zuhören, über Gefühle und Wettkampf verstärken diesen ›publication bias‹ weiter. Der ›Publikationsbias‹ ist die statistisch verzerrte Darstellung der Datenlage, die daher rührt, dass Studien mit signifikantem Ergebnis (»Es besteht ein angeborener Unterschied zwischen den Geschlechtern«) eher in wissenschaftliche Publikationen aufgenommen und stärker finanziell gefördert werden. Über sie wird dann auch öfter und ausführlicher berichtet als über Studien mit nichtsignifikanten Ergebnissen (»Es besteht kein angeborener Unterschied zwischen den Geschlechtern«). Die US-amerikanische Soziologin Carol Hagemann-White konnte schon 1984 nachweisen, dass vor allem die deutschsprachige Literatur dazu neigt, Geschlechtsunterschiede als massiv und angeboren zu beschreiben 18. Bei näherer Analyse der Untersuchungen würden sich die aufgestellten Behauptungen meist als unhaltbar herausstellen. Doch um an Fördergelder zu kommen, müssen Untersuchungen so angelegt sein, dass sie nach einem Unterschied suchen. Ob der dann groß ist oder eher verschwindend gering, spielt am Ende keine entscheidende Rolle. »Somit ist schon vom Forschungsdesign her gar kein anderes Ergebnis möglich, als Differenzen zwischen Frauen und Männern festzustellen. Dabei zeigen sich überall, also beispielsweise bei Hormon- und bei Gehirnuntersuchungen, meist viel größere Unterschiede innerhalb einer Gruppe, also etwa innerhalb der Gruppe ›Männer‹«, so der Biologe Heinz-Jürgen Voß 19.
In ihrem Buch »Die Geschlechterlüge. Die Macht der Vorurteile über Frau und Mann« 20hat die Neuropsychologin Cordelia Fine zahlreiche Studien aus den unterschiedlichsten Bereichen versammelt, die sich damit befassen, ob und worin Frau und Mann, Mädchen und Junge sich unterscheiden. Sie beweist anschaulich und im Detail, dass es zu jeder Untersuchung, die einen natürlichen , also angeborenen Unterschied ergab, auch eine aktuellere Studie gibt, die das Gegenteil herausgefunden hat. An zahlreichen Beispielen führt sie vor, dass Untersuchungen, die vermeintlich große Unterschiede zwischen den Geschlechtern beobachten konnten, in aller Regel schon in Fragestellung und Versuchsaufbau entscheidende Details unberücksichtigt ließen oder den Einfluss der Sozialisation zu wenig bedachten und so zu fehlerhaften Ergebnissen führten. Darunter Studien, denen zufolge das Testosteron schon im Mutterleib auf die Gehirnentwicklung des Fötus Einfluss habe und so ein ›weibliches‹ und ein ›männliches‹ Gehirn entstehen lasse. Das vielfach gezeichnete Bild einer »vorgeburtlichen Testosteronschwemme« oder einer »Testosterondusche« wirkt derart eindrücklich, dass wir automatisch glauben, sie müsse Konsequenzen haben. Doch tatsächlich lässt sich die effektive Konzentration eines Geschlechtshormons im menschlichen Körper bisher gar nicht exakt messen, schreibt die Neurobiologin Lesley Rogers von der University of New England in »Sexing the Brain« 21. Der im Speichel gemessene Testosteronwert sagt zum Beispiel nicht automatisch etwas über das Testosteron aus, das auf das Gehirn wirkt. Darüber hinaus konnte der Bochumer Biopsychologe Markus Hausmann nachweisen, dass sich der Hormonspiegel während und durch eine Untersuchung verändern kann 22. Er ließ zwei gemischte Gruppen von Männern und Frauen mentale Rotationsaufgaben lösen, sie sollten also mehrdimensionale Objekte im Geist drehen. Durch suggestive Einstiegsfragen (»Ist jemand, der gut räumlich denken kann, eher ein Mann oder eine Frau?«) wurde die eine Gruppe auf die gängigen Geschlechterstereotype aufmerksam gemacht. In der anderen Gruppe wurden dieselben Fragen nicht mit Mann/Frau, sondern mit Nordamerikaner/Europäer gestellt (»Ist jemand, der gut räumlich denken kann, eher ein Amerikaner oder ein Europäer?«). In der ersten Gruppe mit Stereotypbedrohung waren die Männer bei den Rotationsaufgaben deutlich besser. In der Vergleichsgruppe dagegen gab es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Als Hausmann im Anschluss an den Test die Hormonspiegel seiner Proband*innen überprüfte, konnte er bei den Männern in der Stereotypgruppe deutlich erhöhte Testosteronspiegel nachweisen. Ihre Gedanken könnten, so Hausmanns Schlussfolgerung, in Verbindung mit der Wettbewerbssituation dazu geführt haben, dass mehr Testosteron ausgeschüttet wurde. Erst der Hinweis also, dass es bei diesem Test um eine Aufgabe geht, von der behauptet wird, dass Männer hier bessere Leistungen erbringen, sorgte für den entsprechenden Hormonschub.
Читать дальше