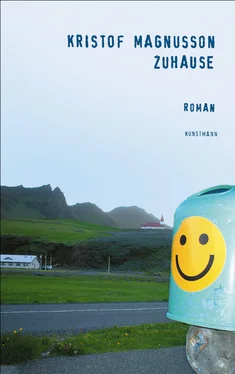»Ich glaube, man verliert die Fähigkeit, sich auf andere Menschen einzulassen, wenn man so lange alleine wohnt.«
Nun war ich es, der sein Weinglas in einem Zug leerte. In Matildas Stimme lag etwas Hoffnungsloses, das ich von ihr nicht kannte, und dass sie in diesem Ton ausgerechnet vom Alleinewohnen sprach, erschreckte mich. Als wir uns als Jugendliche unser erwachsenes Leben vorstellten, hatten wir uns ausgemalt, wie schön es sein würde, endlich unsere eigenen Wohnungen zu haben, jeder für sich. Sobald wie möglich machten wir diesen Traum wahr, Matilda im achten Stock am Laugar-Tal und ich in Hamburg in einem seine Renovierung erwartenden Vorkriegsklinkerbau auf der Veddel, einer Insel, die weder zum Nord- noch zum Südufer der Elbe gehört. Die erhebende und gleichzeitig verunsichernde Freiheit genossen wir wie einen Rausch, der auch nach den Jahren und den mit ihnen verbundenen Geschichten weiter wirkte. Doch etwas in ihrer Stimme ließ mich an eine Abmachung denken, die wir vor vielen Jahren trafen und die ich inzwischen fast vergessen hatte: Bevor wir beginnen würden, uns selbst Botschaften auf den beschlagenen Badezimmerspiegel zu schreiben und uns nachmittags beim Bäcker über den Klang der eigenen Stimme zu wundern, würden wir zusammenziehen. Sie und auch ich konnten jederzeit den anderen darum bitten, wenn wir es allein nicht mehr aushielten. Ich hatte nie daran gedacht, dieses Versprechen einzulösen, und es mit vielen anderen Gin-Launen in einer schwer zugänglichen Region meines Gedächtnisses abgelegt. Nun hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass sie daran dachte. Ich sah mich in meiner Wohnung um. Das einzige wirkliche Möbelstück war das blaue Sofa, auf dem ich saß. Von ihm aus betrachtete ich den Deckenfluter an der gegenüber liegenden Wand, den Glastisch mit meinem Obststillleben und Matilda in ihrem Sessel. Plötzlich stand dieses dumme Versprechen, wenn schon nicht zwischen uns, so doch zumindest hier im Raum, mitten in meinem Wohnzimmer.
Als der Zapfkarton leer war, gingen wir aus. Wir ließen uns, den Nordwestorkan im Rücken, runter in die Stadt treiben und taten das, was alle taten: Wir gingen auf den Laugavegur, die oft verregnete, immer zu enge und irgendwie auch zu lange Hauptstraße Islands.
Es war kurz nach eins. Eine Autoschlange schob sich langsam stadteinwärts, in Richtung Nacht, in Richtung Leben. Wir gingen an einem von Techno-Bässen geschüttelten Geländewagen vorbei, in dem ein einzelner Mann saß. Er hatte das Fenster heruntergekurbelt und ließ eine Hand heraushängen, in der er eine Dose Cola hielt. Dahinter war ein glänzender Golf, dessen Heckklappe offen stand. Aus seinem Inneren drangen die Beats der Reykjavíker Hip-Hop-Helden XXX Rottweiler Hundar. Unbeeindruckt davon, dass die Heckklappe im Sturm zitterte, saßen zwei Jungs im Kofferraum und redeten gleichzeitig auf ein Mädchen ein, das zwischen ihnen saß. Sie tranken Bier aus Dosen, ihre Beine berührten fast die Straße. Das Mädchen sprang heraus, rannte auf ein anderes Mädchen zu, das gerade im 22 verschwinden wollte, und rief den Jungs zu: «Das ist meine Cousine. Meine Cousine Hulda.«
Weil viele Autofahrer Fußgänger trafen, die sie zumindest hupend begrüßen mussten, wenn sie nicht sogar anhielten, um sich grölend über das Ziel der bevorstehenden Nachtvergnügung zu verständigen, kam der Verkehr vollkommen zum Erliegen.
Auf den Parallelstraßen wäre man viel schneller vorangekommen, und doch fuhren alle den Laugavegur hinab. Alle halfen mit, wenigstens freitags und sonnabends einen Verkehrsstau zu erzeugen, wie er sich in Reykjavík sonst selbst im dichtesten Berufsverkehr nicht einstellen wollte. An den Wochenenden zwischen ein und sechs Uhr wirkte die Stadt so großstädtisch wie nie. Alle stürzten sich in das Nachtleben, diese kollektive Auflehnung gegen den Winter, die Dunkelheit, Langeweile, Pizzabringdienste, Chat-Rooms und Pay-TV.
Wir ließen eine Ginflasche kreisen, wobei – ein richtiger Kreis war es nicht. Eher eine Gerade, auf der die Flasche hin- und herpendelte, zwischen Matilda und mir. Dabei freute ich mich nicht nur auf die Nacht, sondern auch auf den nächsten Morgen. Es kam immer so, dass wir, wenn wir überall gewesen waren, bei Matilda weitertranken, bis der Erste von uns auf einer ihrer Fensterbänke einschlief, die leer waren und breit wie Betten. Nirgendwo schlief ich so gut wie dort, Reykjavík mit seinen erleuchteten Hügeln und der schwarzen Bucht unter mir. Und das Aufwachen in der übersäuerten Einsamkeit des nächsten Tages war niemals schrecklich, weil wir weder allein aufwachten noch in dem Bett eines unbekannten, im aufkommenden Tageslicht hässlicher werdenden Menschen.
Wir waren auf dem Weg ins kaffi gógó. Dort waren wir das erste Mal vor vierzehn Jahren gewesen, als wir gerade angefangen hatten, in uns mehr zu sehen als den Jungen und das Mädchen mit den Kleinbildkameras. Wir hatten unsere Freundschaft aus den Kinder- und Lebertranpillentagen herübergerettet in ein Erwachsenengefühl, das seit einiger Zeit wie ein dem Schlamm Nibelheims entstiegenes Monster in uns herumtorkelte. Wir hatten uns vorgenommen, zum ersten Mal in der Innenstadt betrunken zu werden. Wir wollten endlich Kontakt aufnehmen mit dem erwachsenen Leben, das aus Freundschaften zu Barkeepern, Türstehern und Tresenmädchen zu bestehen schien. Wir wollten dazugehören, zu den hart gesottenen Twens, geheimnisvollen Fischerburschen und trägerlosen Björk-Nachahmerinnen, die an der Bar im kaffi gógó ihre Nierenknuffe setzten und im Obergeschoss auf den Sofas knutschten. Matilda hatte ihre Mutter gebeten, zum Schwarzen Schwan am Busbahnhof Hlemmur zu gehen und französische Zigaretten in roten Schachteln zu kaufen. Zusätzlich hatte ich aus Hamburg zwei Zigarettenpackungen mitgebracht, von deren Steuermarken wir eine Eins und eine Zwei ausschnitten und über die Fünf der 1975 auf unseren Ausweisen klebten. So kamen wir an dem Türsteher vorbei. Drinnen verlangte ich mit einem Nuscheln, das zumindest damals für mich der kettenrauchenden Nonchalance eines Godard-Schauspielers ebenbürtig war, einen Aschenbecher und kaufte Bier. Der erwartete Kampf an der Bar blieb dabei aus, denn bis auf uns war noch keiner da. Wir setzten uns im Obergeschoss auf die Fensterbank unter dem Straßenschild aus Amsterdam und schauten lange in den regennassen Hinterhof mit den Lüftungsschächten. Als sich das gógó langsam füllte, entpuppte sich die Fensterbank als Logenplatz, um zuzusehen, wie um uns herum alles aus dem Ruder lief. Eine Frau in hohen Stiefeln schlug ihrem Freund weinend ins Gesicht. Ich unterhielt mich mit einer betrunkenen Krankenschwesterschülerin, die sich mühsam an der Handtasche unter ihrem Arm festhielt und mich zweimal grinsend fragte: »Deine Freundin ist nicht deine Freundin, oder?« Als die Krankenschwesterschülerin mich küssen wollte, ging Matilda aufs Klo, und als ich die Krankenschwesterschülerin nicht küssen wollte, sagte diese: »Denk dran, ich werde Krankenschwester. Irgendwann wird dein Leben einmal in meiner Hand sein.«
Am Anfang dieses ersten Abends im Reykjavíker Nachtleben war ich fest entschlossen, mich im kaffi gógó zu bewegen wie ein The Clash hörender Nordengländer mit einer Narbe in der Augenbraue und einer Rule Britania-Tätowierung auf dem mächtigen Bizeps. Als ich jedoch zum dritten Mal die Treppe hinabging, um für Matilda und mich ein viertes Bier zu holen, wurden meine Beine plötzlich leicht. Mir war Barbra Streisand eingefallen, und während ich langsam, Schritt für Schritt, die Treppe hinunterstieg, sang ich leise vor mich hin: There’s no business like show business.
Wie jeder Stammgast hatte ich eine Theorie, warum das kaffi gógó nie aus der Mode kam: Es war der einzige Club mit einer Dramaturgie. Im gógó musste man keine Fragen stellen und keine Entscheidungen treffen: Das gógó könnte mindestens bis sechs Uhr offen bleiben wie die meisten anderen Clubs, machte aber um vier Uhr fünfzehn dicht. Punkt vier Uhr fünfzehn. Weil das alle wussten, achteten sie darauf, um zwei in bester Stimmung zu sein und sich um halb vier vor der Bar in erbitterte Kämpfe um ein letztes Getränk zu verwickeln. Wenn dann genau um vier, mitten im Lied, die Musik abbrach und das Licht anging, konnte man sich noch eine Viertelstunde an die Reste der Nacht klammern. In den anderen Läden, die bis sechs offen hatten, zerfaserte die Nacht. Dort waren einige bereits um Mitternacht betrunken, während die anderen blöd guckten, und wenn die, die um Mitternacht noch blöd geguckt hatten, um drei betrunken waren, waren die anderen, bereits um Mitternacht Betrunkenen, schon gar nicht mehr wach.
Читать дальше