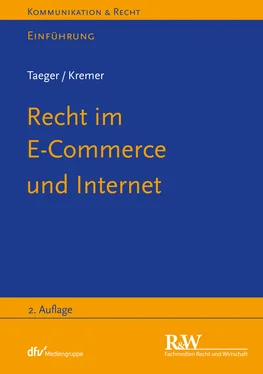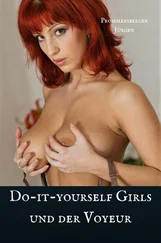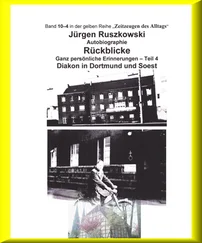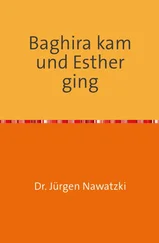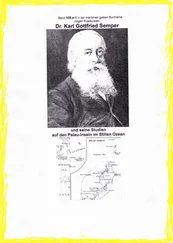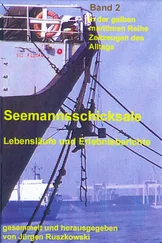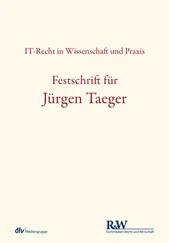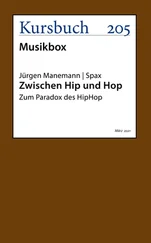56Beispiele bei H. Schmidt, in: BeckOK-BGB, 2020, § 306 Rn. 27. 57Kollmann, in: Dauner-Lieb/Langen, BGB, 2021, § 306 Rn. 34; H. Schmidt, in: BeckOK-BGB, 2020, § 306 Rn. 27.
45
Befähigt zur Klageerhebung mit Folge der Überprüfung von AGB sind zunächst die Vertragsparteien im Rahmen des Vertragsverhältnisses, so sie aus den AGB bzw. aus deren Nichtgeltung Rechte ableiten. Daneben sind gemäß § 3 UKlaG unter anderem Verbraucherverbände, Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen sowie Industrie- und Handelskammern befugt, gegen die Verwendung der AGB zu klagen, wenn diese mit den §§ 307 bis 309 BGB unvereinbar sind, § 1 UKlaG. Die AGB müssen nicht vorher durch ein Gericht bereits für unzulässig erklärt worden sein,58 wenngleich der Wortlaut eine solche Interpretation durchaus zuließe. Sinn und Zweck des Verfahrens nach §§ 1, 3 UKlaG ist gerade die Feststellung der Unwirksamkeit bestimmter Klauseln, nicht die erneute Aburteilung einer bereits für rechtswidrig erachteten Praxis.59
Fragen und Aufgaben
1. Wie häufig muss nach der ständigen Rechtsprechung ein Vertrag verwendet werden, damit er als AGB qualifiziert werden kann?
2. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Versandhändlers befindet sich folgende Formulierung: „Gewährleistung...Sollte ein bestimmter Artikel nicht lieferbar sein, senden wir Ihnen in Einzelfällen einen qualitativ und preislich gleichwertigen Artikel (Ersatzartikel) zu. Auch diesen können Sie bei Nichtgefallen innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Sollte ein bestellter Artikel oder Ersatzartikel nicht lieferbar sein, sind wir berechtigt, uns von der Vertragspflicht zur Lieferung zu lösen; wir verpflichten uns gleichzeitig, Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und etwa erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zu erstatten.“Liegt ein Verstoß gegen §§ 305ff. BGB vor?
3. Unternehmer A preist über seine Website Waren an. Seine AGB hat er in der Weise verlinkt, dass sich nach dem Betätigen des Buttons „AGB“ eine Scrollbox auf dem Bildschirm des Interessenten öffnet. Die Auflösung des Inhalts und die Scrollbox sind so dimensioniert, dass der Leser immer nur kleine Ausschnitte der AGB lesen kann. Um einen weiteren Ausschnitt der umfangreichen AGB zu erfassen, ist häufiges Scrollen erforderlich. Ist diese Darstellung zulässig?
4. Unternehmerin A bietet über ihre Website Waren an. Um eine größere Reichweite zu haben, bietet sie neuerdings die Website auf Deutsch, Englisch und Französisch an. Hat dies Auswirkungen auf die bereits von ihr verwendeten AGB?
5. Stellt ein Unternehmer seine Website auch als sog. mobile Ansicht zur Verfügung, sprich für mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets, muss er dann zusätzliche Voraussetzungen beachten oder kann er einfach einen Link zu den AGB setzen, wie er das auf der Website auch macht?
6. Der Unternehmer A widerspricht in seinen AGB etwaigen AGB des jeweiligen Vertragspartners. Der Unternehmer B schließt mit A einen Vertrag ab und fügt der Vertragsannahme seine AGB bei, in denen er seinerseits den AGB des jeweiligen Vertragspartners widerspricht. Nun gelten die AGB des B, da sein Widerspruch den Widerspruch in den AGB des A aushebelt. Richtig?
7. Unternehmerin A verwendet folgende Klausel in ihren AGB: „Wenn Sie uns keinen bestimmten Wunsch mitteilen, wird der Wert der Rücksendung Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben oder Sie erhalten beim Nachnahmekauf einen Verrechnungsscheck.“ Bestehen rechtliche Bedenken?
58Walker, in: Dauner-Lieb/Langen, BGB, 2021, § 1 UKlaG Rn. 8. 59Walker, in: Dauner-Lieb/Langen, BGB, 2021, § 1 UKlaG Rn. 10.
Kapitel 4
Formerfordernis und elektronische Signatur
Übersicht
|
Rn. |
| I. Grundsatz der Formfreiheit |
1 |
| 1. Funktionen der Schriftform |
2 |
| 2. Schriftform und neue Medien |
4 |
| II. Rechtslage nach den früheren Signaturgesetzen |
7 |
| 1. Einfache elektronische Signatur |
11 |
| 2. Fortgeschrittene elektronische Signatur |
12 |
| 3. Qualifizierte elektronische Signaturen |
13 |
| III. Rechtslage nach der eIDAS-Verordnung der EU |
14 |
| 1. Allgemeines |
14 |
| 2. Anwendungsvorrang |
17 |
| 3. Elektronische Identifizierung |
19 |
| 4. Vertrauensdienste |
22 |
| 5. Elektronische Signaturen und elektronisches Siegel |
25 |
| IV. Anpassung der Formvorschriften im Privatrecht |
28 |
| 1. Elektronische Form, §§ 126 Abs. 3, 126a BGB |
29 |
| 2. Textform, § 126b BGB |
32 |
| 3. Ausschluss der elektronischen Form |
38 |
| 4. Elektronischer Rechtsverkehr |
40 |
| 5. Beweiswert elektronischer Dokumente im Rechtsstreit |
45 |
| a) Beweiswert einfacher elektronischer Dokumente |
46 |
| b) Beweiswert elektronischer Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur und von De-Mails |
48 |
| V. Signaturverfahren |
51 |
I. Grundsatz der Formfreiheit
1
Grundsätzlich unterliegen Rechtsgeschäfte zwischen Privaten keinen Formerfordernissen. Das ergibt sich im Umkehrschluss aus § 125 BGB, der die Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts nur ausnahmsweise als Folge vorsieht, wenn es dem Rechtsgeschäft an der durch Gesetz oder nach dem Willen der Vertragspartner gewünschten Form mangelt. Diese Formfreiheit ist ein Ausfluss der Privatautonomie und bedeutet, dass Verträge geschlossen werden können, ohne dass die Vertragspartner dabei eine bestimmte Form beachten müssen. Für einige Rechtsgeschäfte hat der Gesetzgeber indes die Schriftform vorgesehen. So wird beispielsweise in § 766 BGB die Schriftform für die Bürgschaftserklärung verlangt, und § 623 BGB ordnet an, dass Kündigungen von Arbeitsverträgen stets schriftlich zu erklären sind.
1. Funktionen der Schriftform
2
Die gesetzliche Schriftform bei bestimmten Rechtsgeschäften soll drei Zwecken dienen. Zum ersten soll dem Erklärenden durch seine Unterschrift bewusst gemacht werden, dass er im Begriff ist, eine rechtlich besonders bedeutungsvolle Erklärung abzugeben (Warnfunktion). Zum zweiten wird durch die Unterschrift die Identität des Ausstellers erkennbar (Identitätsfunktion). Letztendlich trägt die Unterschrift am Ende des Textes als dessen Abschluss zur Klärung des Textinhalts bei (Beweisfunktion).1
3
§ 126 Abs. 1 BGB normiert, dass für die gesetzliche Schriftform die Urkunde am Ende eigenhändig vom Erklärenden unterzeichnet werden muss. Im Falle des gegenseitigen Vertrages müssen beide Parteien die Urkunde unterzeichnen (§ 126 Abs. 2 S. 1 BGB). Wird diese Form nicht beachtet, führt dies zur Nichtigkeit des Vertrages (§ 125 BGB).
2. Schriftform und neue Medien
4
Die technischen Entwicklungen der letzten Jahre lassen diese Regelungen als überkommen erscheinen. Zum Abschluss eines rechtsgültigen Vertrages ist es heute oftmals weder nötig, dass sich die Vertragspartner persönlich kennen, noch, dass sie Erklärungen in Papierform erhalten. Digital übermittelte Willenserklärungen, die zum Abschluss eines Vertrages führen können, genügen dem Schriftformerfordernis des § 126 Abs. 1 BGB naturgemäß nicht.2 Die Vereinfachung, die der Vertragsschluss über das Internet erfahren soll, wird an dieser Stelle für nach dem Gesetz oder dem Willen der Vertragspartner formbedürftige Rechtsgeschäfte unmöglich gemacht.
Читать дальше