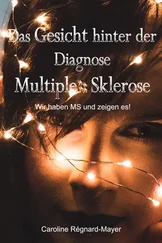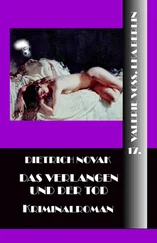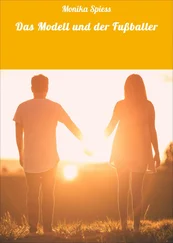Hier, in dieser Landschaft, herrschten die Bestimmungen der Zeitlosigkeit. Und die der grenzenlosen Hoffnung und unerbittlichen Freiheit. Ihr alle, liebe Bergsteiger, kennt dieses Gefühl des Urvertrauens, frei von anerzogener Strenge und Intellektualität.
Ohne jede emotionale Reaktion wandte ich mich ab und meinem Weiterweg zu. Ich ging aus dieser vom Halbmond erhellten Szenerie in die endgültige Nacht hinein und erreichte gegen Morgengrauen einen Ort, der auf der Karte als Lunag bezeichnet war. Der Ort bestand aus zwei winzigen, eingefallenen Almhütten und lag am östlichen Rand des Lunag-Gletschers auf einer Höhe von etwas mehr als fünftausend Metern. Die Stille der Landschaft war nur durch das ferne Krachen von Eislawinen unterbrochen. Ich kletterte auf einen etwa zehn Meter hohen Felsen und schlief auf seinem flachen Gipfel für einige wenige Stunden. So hatte ich es auch auf dem Herweg gehalten, wo auch immer die Möglichkeit dafür bestanden hatte. Denn es gab hier manchmal Räuber, so hatte ich mir erzählen lassen, und ich wollte ihnen nicht in die Hände fallen.
Ein Jahr später berichtete man mir in Kathmandu, dass Monate danach ein Franzose meinem Weg gefolgt war. Er war nicht wiedergekommen. Man fand schließlich nur mehr seinen kopflosen Körper, was auf einen Überfall durch tibetische Räuber schließen ließ. (Tibetische Räuber pflegen die Köpfe ihrer Opfer zu vergraben, denn nach ihrer Überzeugung verrät die Richtung der Augen den Wohnort der Täter.)
Ich brach wieder auf und marschierte nach einigen Stunden wieder in die beginnende Nacht hinein, denn ich musste jetzt vorwärts kommen, weil ich mir in meinem geschwächten Zustand keine zusätzlichen Risiken wie etwa einen Wettersturz mehr erlauben durfte. Ich hatte schon am Tag vorher begonnen, Ausrüstungsgegenstände, die ich nun nicht mehr benötigte, zurückzulassen, um meine Last zu erleichtern. Und so folgten jetzt, besonders bei Gegenanstiegen, erst die Zeltstangen, dann die Steigeisen, die beiden Eispickel, die Reservekartuschen. Ich warf sie einfach zur Seite, fast während des Gehens, wie lästig gewordene Anhängsel.
Wieder war es fast Mitternacht, als ich am Rande einer fast senkrechten, etwa hundert Meter hohen Moräne ankam. Die Batterien meiner Stirnlampe waren leer, und ich wollte die Tiefe der Moräne auskundschaften, indem ich mehrfach Streichhölzer anzündete und sie ins Leere warf. Doch sie verloschen allesamt nach kürzester Zeit und erleuchteten die dunkle Unendlichkeit unter mir kein bisschen.
So ist das menschliche Dasein, dachte ich mir: Man kann nicht anders, als einen Stein in den Nebel zu werfen, und kann nicht anders, als ihm zu folgen. (Neurologen würden das vermutlich, wenig romantisch, als Aufforderungshaltung des Großhirns erklären.)
Ich kletterte über die Moräne nach unten, und wirklich war sie sehr steil, ja fast senkrecht. Ich hielt mich an größeren Felsbrocken, die mir vertrauensvoll erschienen, und lauschte bang den kleineren Steinen, die ich durch meine Bewegungen losgelöst hatte, wie sie in weiten Sprüngen nach unten fielen. Der Wind trug den Schwefelgeruch ihres Aufschlags zu mir herauf. Nach einiger Zeit der völligen Konzentration hatte ich den Fuß der Moräne erreicht und damit den sicheren Boden des Toteisgletschers. Dann ging ich in den beginnenden Morgen hinein und rastete nur einmal auf einem Stein, während sich die hinter mir liegende Moräne langsam aus dem Grau löste. Ich staunte. Die Moräne sah von hier aus, bedingt durch die Entfernung und die sich daraus ergebende Perspektive, wirklich beinahe senkrecht aus. Es erschien mir wie ein Wunder, dass ich sie ohne jedes Licht bewältigt hatte. Ich war also nun in Sicherheit und dachte nur noch einmal an den Bären, an meinen sehr persönlichen Bären, und was wohl seine Warnung gewesen war. Dann wandte ich mich wieder um. Und plötzlich, am Ende des Gletschers, sah ich das, was ich wie eine Erlösung empfand. Hier hatten mich vor vier Wochen meine vier Träger aus dem Rolwaling aus Angst verlassen, aus durchaus berechtigter Angst vor mir Verrückten, der ich mich auf den Entdeckerspuren von Sven Hedin und Herbert Tichy empfand, wenn auch nicht streng geographisch, doch auf jeden Fall ideell, und ich war mit der verbliebenen Last von neunzig Kilogramm allein weitergezogen, über den gut fünftausendsiebenhundert Meter hohen Nangpa La. (Francek Knez, der berühmte slowenische Bergsteiger, bei dem ich mich im Basislager unter der Südwand des Cho Oyu aufgehalten hatte, hatte irgendetwas wie „heilige Mutter Gottes“ gemurmelt, als er meine Last zu heben versuchte.)
Ich hatte lange Zeit kein Gras mehr gesehen. Aber der Wind, mein vertrauter, ständiger Begleiter, spielte nun mit den dürren Gräsern einer Almwiese, und da und dort lag auch schon ein Flecken Sonne in unerhörter Heiterkeit darin, und ein kleines, bequemes, sicheres Steiglein führte durch das fast ebene Tal hinaus, dorthin, wo die Menschen waren.
Wolfi, der Dhaulagiri und die blauen Bomber
Das Bergsteigen erzählt nicht allein eine Geschichte der Triumphe, wie es manches Mal den Anschein hat, sondern vielleicht mehr noch eine Geschichte des Scheiterns. Es gibt Berge, die sich als Schauplätze des Scheiterns besonders gut eignen, und der Dhaulagiri gehört zweifelsohne dazu, weil sich durch seine schiere Größe, Höhe und Exponiertheit jede aufziehende Schlechtwetterfront an seinen riesigen Wänden bricht. Ausgerechnet dorthin wollten wir, um unser Mütchen zu kühlen.
Weil die meisten von uns mittellos waren, wie damals und auch heute noch fast alle Bergsteiger, nahmen wir gern Hilfe von außen in Anspruch. Zur finanziellen Unterstützung durch einen Pharmakonzern, der Hausmann & Boche oder so ähnlich hieß, mussten wir uns allerdings verpflichten, ein neuartiges Schlafmittel auszuprobieren, das damals noch nicht auf dem Markt war. Wir willigten ein, teilten uns brüderlich die zwanzigtausend Schweizer Franken und fuhren los. Der durchschlagenden Wirkung wegen und aufgrund der Form und Farbe dieser Tabletten sollten wir das Schlafmittel wenig später „den blauen Bomber“ nennen.
Voller Vorfreude auf unser Abenteuer, aber des langen Fluges wegen ziemlich übermüdet in Kathmandu gelandet, tranken wir auf meinem Hotelzimmer noch einen Whisky, um mit dem darauf folgenden Nachmittagsschläfchen dem Jetlag den Garaus zu machen. So saßen wir zu dritt, Wolfi und ein anderer Expeditionsteilnehmer und ich, und prosteten uns fröhlich zu.
Ich habe schon immer eine gewisse Schwäche für medizinische Selbstversuche gehabt und fand es deshalb eine gute Idee, den bislang unerprobten blauen Bomber gleich hier und jetzt, in der Sicherheit des Hotelzimmers, zu verkosten. Flugs war die ansehnliche blaue Pille mit einem Schluck Whisky hinuntergespült. Wenig später wurden die Gespräche auffallend philosophisch. Der Expeditionskamerad stellte eine komplexe Frage und Wolfi hörte schweigend zu. Meine Antwort war in einem solchen Maße verdichtet und intelligent und umfassend, dass ich noch heute überzeugt bin, den bedeutendsten Satz meines Lebens von mir gegeben zu haben. Wolfi blickte mich verständnislos an (und ebenso der andere Kamerad), rang sich jedoch zur Feststellung durch: „Das habe ich jetzt nicht verstanden!“
Ich übte mich in Geduld.
„Schau“, sagte ich, „das ist doch einfach und so kristallklar.“ Dann versuchte ich die Antwort zu wiederholen, merkte aber dieses Mal am Ende des Satzes, dass die kristallene Klarheit in meinem Gehirn nicht mehr bis zur Zunge gelangt war. Irgendetwas war hier auf einmal nicht mehr koordiniert. Dann weiß ich von nichts mehr. Meine Kameraden erzählten mir, ich sei im gleichen Moment mit dem Stuhl umgefallen und auf der Stelle eingeschlafen, worauf sie mich zu Bett brachten und zudeckten. Das war der Auftakt unserer medizinischen Forschungsfahrt zum Dhaulagiri.
Читать дальше