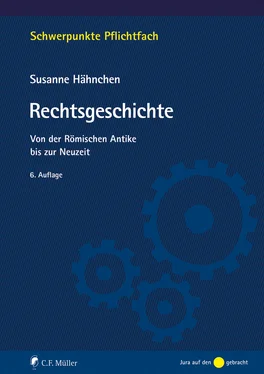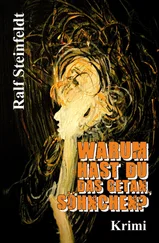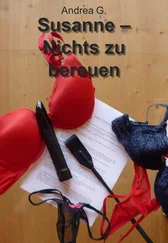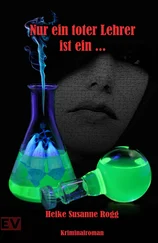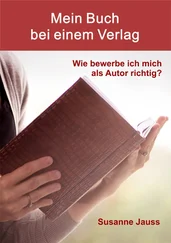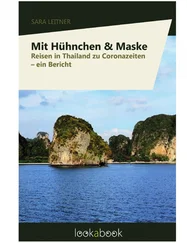Ebenfalls Schüler und Beisitzer Papinians war Domitius Ulpian(us) aus Tyros in Phönizien. Er hat noch mehr geschrieben als Paulus, war aber weniger originell. Etwa ein Drittel der Digesten Justinians besteht aus Zitaten seiner Werke. Von Kaiser Elagabal verbannt, holte ihn dessen Nachfolger, der noch minderjährige Severus Alexander in das nach dem Kaiser höchste Staatsamt des praefectus praetorio zurück. Ulpian übte auf den jungen Kaiser erheblichen Einfluss aus, was immer wieder zu Machtkämpfen führte, als deren Folge er vermutlich 223 n. Chr. bei einer Revolte seiner Prätorianer getötet wurde.
Als letzter Klassiker gilt Herennius Modestin(us), wohl ein Schüler Ulpians. Er bekleidete zwischen 224 und 244 n. Chr. das Amt des praefectus vigilum ( Rn. 141), erteilte dem Sohn des Kaisers Maximinus Thrax (235-238) Rechtsunterricht und 239 n. Chr. folgte Kaiser Gordian III. in einem Reskript ( Rn. 158) einem Gutachten des Modestin.
171
Zur allgemeinen Charakterisierung der Schriften der Klassiker ist hervorzuheben, dass sie sich streng an die Erörterung konkreter Fälle halten. Ihre Entscheidungen sind knapp, oft gar nicht begründet. Sie sollen aus sich selbst heraus überzeugen. Gegenüber Verallgemeinerungen, Regeln, Definitionen waren die Klassiker skeptisch.
Das klassische Recht ist weit entfernt davon geblieben, ein geschlossenes System zu bilden. Allgemeine Regeln etwa über Willenserklärungen, Verträge und Leistungsstörungen wurden nicht aufgestellt. Insofern könnten manche moderne Lehrbücher des römischen Privatrechts einen falschen, auf den Systematisierungen der Pandektistik insbesondere im 19. Jahrhundert (Rn. 738) beruhenden, Eindruck vermitteln. Einschlägige Probleme wurden nur im Hinblick auf konkrete Vertragstypen erörtert. Der Irrtum etwa wurde nicht allgemein (wie in § 119 BGB) behandelt, sondern im Hinblick auf die Kaufsache ( Rn. 184).
In manchen Fragen bildeten sich „herrschende Meinungen“, bezeichnet mit placuit oder placebat (von placere = gefallen, zusagen, billigen); placet deutet daraufhin, dass es sich um die Ansicht eines Juristen handelt. Maßgebende Entscheidungsgesichtspunkte waren die berechtigten Interessen der Beteiligten und das Beherrschungsvermögen, aber auch die Billigkeit (aequitas) im Sinne gerechter Güterzuteilung. Gelegentlich wurden philosophische Erwägungen herangezogen. Das gilt nicht nur für die Definition des Rechts überhaupt, sondern auch für Einzelfragen, etwa die Abgrenzung relevanter Irrtümer von irrelevanten oder das Eigentum an einer durch Verarbeitung entstandenen Sache ( Rn. 164). Hier überzeugen die Ergebnisse oft weniger.
172
Während wir es gewohnt sind, zunächst die materielle Rechtslage zu klären – z. B. das Bestehen eines Vertrages oder den Verbleib des Eigentums – und erst dann die sich daraus ergebenden Ansprüche (etwa aus § 433 oder § 985 BGB) sowie Rechtsbehelfe (Klagen usw.) ermitteln, gingen die römischen Klassiker in ihrer Argumentation direkt von der actio (Klage) aus.[17] Das materielle Recht erscheint in ihren Schriften als Anhängsel der actio . Solches „aktionenrechtliches Denken“ gibt es aber manchmal auch im modernen Recht, z. B. in den Art. 16 Abs. 2 WechselG, 21 ScheckG. Dort tritt das materielle Recht am Wechsel bzw. Scheck hinter dem Herausgabeanspruch zurück. Oder: Vom Herausgabeanspruch hat man auf das zugrunde liegende materielle Recht zu schließen. Auch im Verfassungs- und Verwaltungsrecht denkt man heute zunächst an die Klage und fragt in diesem Rahmen nach den Rechten.
173
Angesichts der sozialen Stellung der großen römischen Juristen überrascht es nicht, wenn das römische Recht als ein Recht aus der Sicht der gehobenen Klassen erscheint („Honoratiorenrecht“). Nicht zuletzt das Klientenwesen und die Möglichkeit der Berufung haben den Juristen aber auch gelegentlich den Blick auf die Rechtsfragen der kleinen Leute eröffnet. So erörtert z. B. Ulpian (Dig. 9, 2, 5) den Fall, dass ein ungehaltener Schuhmacher seinen Lehrling mit dem Leisten schlägt und der Lehrling dabei ein Auge einbüßt, oder Paulus (Dig. 18, 16, 13) den Sachverhalt, dass ein Ädil, um Ordnung zu schaffen, verkaufte, auf öffentlicher Straße gelagerte Bettgestelle zerschlagen lässt.
Ein besonderer, ebenfalls schon hervorgehobener Zug des klassischen Privatrechts ist die Abgehobenheit, die „Isolierung“ von der sozialen Wirklichkeit seiner Zeit ( Rn. 148), die durch kaiserlich-staatliche Reglementierung determiniert war. So erscheint der Eigentümer des klassischen Privatrechts frei, während er in Wirklichkeit durch viele Vorschriften der Polizeiverwaltung eingeengt war, beispielsweise auch umweltrechtliche.[18] Dieser Zug zeigt sich noch Ende des 19. Jahrhunderts, bei der Entstehung des BGB (Rn. 734)
2. Weitere Institutionen des klassischen Privatrechts
174
Einige grundlegende Institutionen sollen noch beschrieben werden, die in den bisher erwähnten Zusammenhängen nicht erschienen.
Im Personenrecht gab es weiterhin die Sklaverei. Immerhin verleugneten die römischen Juristen nicht ganz ihr schlechtes Gewissen gegenüber dieser Erscheinung, akzeptierten sie jedoch als unabänderliche Gegebenheit ihrer Zeit.
Nach dem Naturrecht gibt es keine Sklaverei, sie ist also gegen die Natur des Menschen. Wie schon die griechischen Philosophen, insbesondere Aristoteles, hatten die römischen Juristen jedoch nur geringe Probleme damit, sie zu rechtfertigen.[19]
175
Feste Altersgrenzen für die Geschäftsfähigkeit gehen wohl auf die Prokulianer ( Rn. 163) zurück. Die infantes (von fari = sprechen, also die, welche noch nicht – vernünftig – sprechen können), Kinder bis zum 7. Lebensjahr, sind geschäftsunfähig (heute § 104 Nr. 1 BGB). Die pupilli (Knaben vom 7. bis 14., Mädchen vom 7. bis zum 12. Jahr) konnten ihnen vorteilhafte Geschäfte abschließen (vgl. § 107 BGB). Sonst bedurften ihre Geschäfte – wenn die pupilli nicht unter väterlicher Gewalt standen – der Zustimmung (auctoritas) ihres Vormundes (tutor) .
Infantes und pupilli waren impuberes (Unmündige). Junge Leute zwischen 12 bzw. 14 und 25 Jahren hießen minores (Minderjährige). Aufgrund der lex (P)laetoria (etwa 200 v. Chr, Rn. 109) gewährte der Prätor den minores eine exceptio oder die restitutio in integrum (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) gegenüber Geschäften, durch die der minor übervorteilt worden war. In diesen Fällen blieb die Verpflichtung des Kontrahenten des Minderjährigen wirksam („hinkende Geschäfte“). War dem minor vom Prätor ein Pfleger (curator) bestellt, so waren die mit Zustimmung (consensus) dieses Pflegers geschlossenen Geschäfte des Minderjährigen auf jeden Fall wirksam.
Feste Altersgrenzen für die Deliktsfähigkeit gab es im römischen Recht nicht (vgl. heute § 828 BGB).
176
Im Familienrecht wurden manus -Ehen ( Rn. 65) in klassischer Zeit nur noch ausnahmsweise, etwa von (heidnischen) Priestern, geschlossen. Sonst war die freie Ehe üblich. Sie beruhte nicht auf Vertrag, sondern wurde als faktischer sozialer Zustand angesehen und konnte von jedem Partner grundsätzlich jederzeit aufgekündigt werden. Allerdings büßte der Mann, der sich ohne triftigen Grund von seiner Frau schied, dabei die dos (Mitgift) ein.
Die dos hatte die Funktion, die Frau nach Ende der Ehe zu versorgen. Das Dotalrecht nimmt in den Digesten breiten Raum ein, da es für vermögende Römer von großer Bedeutung war. Starb der Ehemann, so konnte die Frau die dos (von seinen Erben) herausverlangen. Starb die Frau, verblieb die dos oft dem Mann, jedoch war diese Regelung nicht einheitlich.
Читать дальше