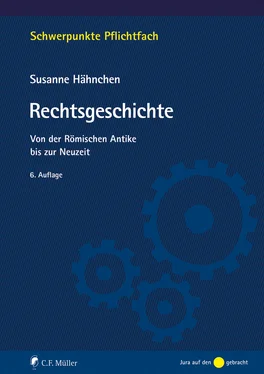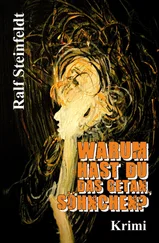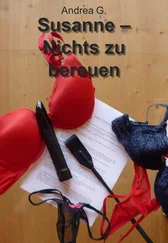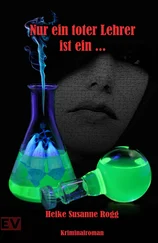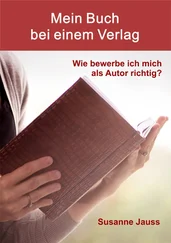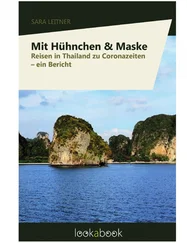Die Religionen der Juden und Christen, die nur einen Gott anerkennen (Monotheismus) mussten mit den Erfordernissen der Staatsreligion in Konflikt geraten. Von den damals im römischen Reich meist aus den östlichen Gebieten vordringenden neuen Religionen trug schließlich nach Wechsel von Tolerierung und Verfolgung unter den verschiedenen Herrschern das Christentum den Sieg davon und wurde im Dominat selbst Staatsreligion ( Rn. 197).
II. Privat- und Prozessrecht
1. Faktoren der Rechtsbildung[3]
148
Unter allen diesen Umständen muss es schon erstaunen, dass sich das römische Privatrecht wenigstens seiner Idee nach als ein Reservat relativer Freiheit erhielt, wenn auch nur für wenige Personen. Die Rechtspraxis wurde jedoch zum einen weitgehend durch außerhalb des Privatrechts bestehende „metajuristische“ Vorgaben bestimmt, wie etwa das Beispiel der Testierfreiheit der Freunde des Kaisers zeigt ( Rn. 146). Auch hat das Recht, anders als die Religion, nicht die Finsternis der sozialen Verhältnisse erhellt. Es war Honoratiorenrecht ( Rn. 173). Nach welchem Recht weniger vornehme Römer (die faktisch die Juristen nicht oder nur selten bzw. mittelbar beschäftigt haben) in der Praxis lebten, wissen wir kaum.
Überliefert ist vor allem Privat- und Prozessrecht. Es wurde später wiederholt zum Begleiter, wenn nicht zum Instrument „fortschrittlicher“ Entwicklungen in Deutschland, so am Ende des Mittelalters, als es das überkommene germanische Recht verdrängte, oder am Anfang des 19. Jahrhunderts, als es zur Grundlage der Rechtsordnung des Bürgertums wurde, das sich aus den Bindungen des Feudalismus und des Absolutismus löste. Begünstigt wurden diese Entwicklungen durch die Abhebung des römischen Rechts von außerrechtlichen Faktoren, insbesondere von politisch-wirtschaftlichen.[4]
Nicht besonders geeignet war dieses Recht, absolute Herrschaft zu rechtfertigen oder zu unterstützen. Zwar hatte man wiederholt versucht, Herrschaftsansprüche mithilfe des römischen Rechts zu legitimieren. Die deutschen Kaiser haben, unterstützt von mittelalterlichen italienischen Juristen, auf die alten Quellen zurückgegriffen (Rn. 382). Beispielsweise der Satz princeps legibus solutus (der Herrscher ist frei von Gesetzen, d.h. er kann sich über das Recht hinwegsetzen) stammt jedoch in dieser Allgemeinheit nicht von den römischen Juristen. Er findet sich etwa in Dig. 1, 3, 31 (von dem spätklassischen Juristen Ulpian), bedeutet dort aber nur, dass der Kaiser den augusteischen Gesetzen gegen Ehe- und Kinderlosigkeit nicht unterlag.
Im Folgenden geht es nun um die Rechtsquellen, aus denen die Römer während des Prinzipats ihr Recht bezogen bzw. die sie selbst für verbindlich hielten.[5] Es ist ein erstaunliches Neben- und Übereinander verschiedener Rechtsschichten zu konstatieren.[6]
a) Vom Kaiser beeinflusste Gesetzgebung
149
Durch seine Ehegesetze hatte Augustus versucht, Moral und Zahl der römischen Bürgerschaft zu erhalten und zu vermehren. Sie gehören zu den noch in der Volksversammlung erlassenen Gesetzen ( Rn. 140). Die lex Iulia de maritandis ordinibus vom Jahre 18 v. Chr., wohl ein Plebiszit, verbot freigeborenen Bürgern die Ehe mit Prostituierten, Kupplerinnen, Ehebrecherinnen und vielleicht sogar mit Schauspielerinnen. Senatoren und ihre männlichen Abkömmlinge durften keine Freigelassenen, Schauspielerinnen oder Schauspielertöchter heiraten. Die entgegen dem Verbot geschlossenen Ehen waren nicht unwirksam; die Ehegatten erlitten aber die gleichen Nachteile wie Unverheiratete. Ebenfalls ein Plebiszit war offenbar die aus dem gleichen Jahr 18 v. Chr. stammende lex Iulia de adulteriis coercendis . Sie enthielt Strafvorschriften gegen Unzucht (stuprum) und Ehebruch (adulterium) .
Auch mit der lex Papia Poppaea (9 n. Chr., wohl ein Komitialgesetz) sollten Ehe und legitime Fortpflanzung gefördert werden. Sie verpflichtete Männer zwischen 25 und 60 sowie Frauen zwischen 20 und 50 zur Ehe. Bürger (und Bürgerinnen) mit mindestens drei, Freigelassene mit mindestens vier Kindern waren ausgenommen. Sanktion für Ehelosigkeit war die Unfähigkeit zu erben. Kinderlose Verheiratete durften nur die Hälfte der ihnen angefallenen Erbschaften oder Vermächtnisse behalten. Die frei werdenden Nachlässe gingen an andere Erben (die Kinder hatten) oder fielen an die Staatskasse (verfallen: caducum , kaduk, vgl. auch Rn. 153). Außerdem waren andere Maßnahmen angeordnet. Der vollständige Inhalt der Gesetze ist nicht mehr bekannt.
150
Die lex Fufia Caninia (2 v. Chr.) hingegen diente der Verhinderung von übertriebenem Luxus. Aus Prahlerei geschahen oft (Massen-)Freilassungen durch Testament. Das Gesetz beschränkte die Freilassungen von Sklaven zahlenmäßig, je nachdem, wie viele Sklaven der Freilasser hatte. So durften etwa von zwei bis zehn Sklaven die Hälfte, von elf bis dreißig nur ein Drittel und nie mehr als 100 Sklaven freigelassen werden.
Eine lex Aelia Sentia (4 n. Chr.) verbot zudem Freilassungen ohne gerechtfertigten Anlass, wenn der Herr noch nicht 20, der Sklave noch nicht 30 Jahre alt war. Freilassungen, welche die Gläubiger des Freilassenden benachteiligten, waren nichtig. Verbrecherische Sklaven wurden bei Freilassung peregrini dediticii ( Rn. 76). Sonst führte die (formgerechte) Freilassung zum Erwerb des römischen Bürgerrechts ( Rn. 42, 61, 174).
151
Später bevorzugten die Kaiser den Senat als Organ der Gesetzgebung ( Rn. 140), obwohl die senatus consulta offiziell nie bindende Wirkung erhielten, sondern nur Empfehlungen darstellten. Da diese Senatsbeschlüsse aber dem Willen des (antragsbefugten) princeps entsprachen, wagte niemand, ihnen zuwider zu handeln. Als Beispiele solcher senatus consulta auf dem Gebiet des Privatrechts werden hier die folgenden angeführt:
Das senatus consultum Velleianum (etwa 46 n. Chr.) erklärte Interzessionen von Frauen für unwirksam. Interzession bedeutet das Eintreten für fremde Schulden, also (befreiende) Schuldübernahme, Schuldbeitritt, Bürgschaft, aber auch Verpfändung und die Aufnahme von Darlehen im fremden Interesse. Grund der Regelung war die damalige Vorstellung, Frauen seien allgemein weichherzig, aber unklug. Praktisch wurde das senatus consultum dadurch verwirklicht, dass die verklagte Frau eine Einrede erhielt (exceptio senatus consulti Velleiani) . Das Interzessionsverbot für Frauen galt im gemeinen Recht bis zum Inkrafttreten des BGB.
152
Hauskinder konnten bekanntlich zu Lebzeiten ihres Vaters für sich selbst kein Eigentum erwerben ( Rn. 67, 133). Zwar waren sie in der Lage, sich zu verpflichten, aber das Vermögen zur Begleichung solcher Schulden fehlte ihnen. Um seine ihn bedrängenden Gläubiger befriedigen zu können, ermordete daher ein Haussohn namens Macedo seinen Vater. Der Kriminalfall bot den Anlass für das senatus consultum Macedonianum (zwischen 69 und 79 n. Chr.), wodurch Gelddarlehen an Söhne, die unter väterlicher Gewalt standen, verboten wurden. Im Formularprozess gewährte der Prätor dem beklagten Haussohn eine Einrede, die exceptio senatus consulti Macedoniani .
153
Mit Rücksicht auf die augusteischen Ehegesetze fielen manche Erbschaften als „kaduk“ an das Aerar oder (später) an den Fiskus ( Rn. 149). Sein Recht an solchen Nachlässen machte der Staat mit der sog. vindicatio caducorum geltend, nicht im Formularprozess, sondern im Verfahren der cognitio ( Rn. 155). Für einen solchen Prozess bestimmte das senatus consultum Iuventianum (129 n. Chr., unter Hadrian), dass der gutgläubige private Besitzer der Erbschaft nur haftete, soweit er noch bereichert war. Hatte er indessen im Bewusstsein des Fehlens seines Rechts gewollt Erbschaftsgegenstände fortgegeben, so war er dafür verantwortlich, d.h. er wurde zur Zahlung eines Geldbetrages verurteilt, der den Wert der fehlenden Gegenstände einschloss. Benannt ist der Senatsbeschluss nach dem Juristen Publius Iuventius Celsus, von dem später noch die Rede sein wird ( Rn. 167). Hier liegt der Ursprung unserer §§ 2018, 2021 BGB, die weitgehend der Regelung des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses (§§ 987 ff BGB) entsprechen. Die §§ 987 ff BGB haben ihre Wurzeln in der Geldkondemnation bei der rei vindicatio ( Rn. 57 ff), in deren Berechnung auch Nutzungen, Schadensersatz und Verwendungen einbezogen wurden.
Читать дальше