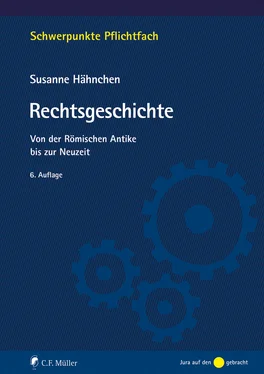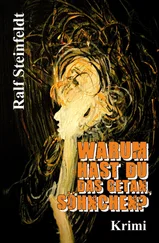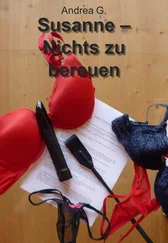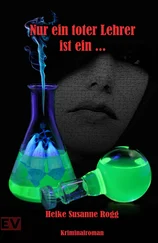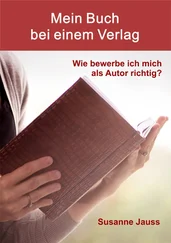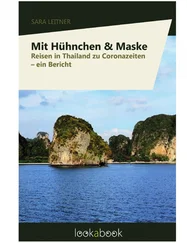142
Wie sich schon aus der vorstehenden Aufzählung ergibt, entstand im Prinzipat ein kompliziertes System der kaiserlichen Verwaltung für Rom und das Reich. Zu erwähnen sind auf diesem Gebiet cohortes urbani (Stadtpolizei), der cursus publicus (Staatspost, nicht für das allgemeine Publikum), die curatores für Wasserleitungen, öffentliche Bauten und anderes. Das vom Senat verwaltete aerarium wurde vor allem von der Grundsteuer aus den Senatsprovinzen und von der Bürger-Kopfsteuer gespeist. In den fiscus Caesaris (kaiserliches Staatsvermögen) gelangten u. a. die Grundsteuern aus den kaiserlichen Provinzen. Das aerarium militare diente der Versorgung der ehemaligen Soldaten (Veteranen) mittels Erbschafts- und Auktionssteuer. Das Privatvermögen des Kaisers (Krongut im Gegensatz zum Staatsgut) hieß patrimonium Caesaris . Kaiserliche Kanzleien waren die officia a memoria (Personalwesen), ab epistulis (Berichte und Anfragen von Beamten) sowie a libellis (private Eingaben, praktisch oft in Rechtsangelegenheiten). Seit Augustus gab es ein stehendes Heer aus Legionen (in den Grenzprovinzen), provinzialen Hilfstruppen (der Dienst bei ihnen führte oft zum Erwerb des römischen Bürgerrechts) und der Prätorianergarde (in Rom).
In der näheren und weiteren Umgebung Roms sollten von Augustus eingerichtete Polizeistationen mit Strafgewalt die innere Sicherheit vor allem auf den Straßen gewährleisten. Die legati Augusti pro praetore in den Provinzen hatten vornehmlich militärische Aufgaben. Mit der Einführung der Besoldung für die Provinzstatthalter (eine Million Sesterzen jährlich für Prokonsulare) verminderte sich die Ausbeutung der Provinzialen. Persönliches „Gehalt“ und Mittel für die Amtsaufgaben waren aber noch nicht getrennt. Provinziallandtage (concilia) , beschickt von Vertretern der Gemeinden, befassten sich vor allem mit dem Kaiserkult, seltener mit Verwaltungsangelegenheiten.
143
Von den Einwohnern des Reiches hatte weiterhin zunächst nur eine Minderheit das Bürgerrecht ( Rn. 42, 75 f). Durch die Gründung von Kolonien und die Erhebung von Gemeinden zu Titularkolonien erhielten jedoch viele Provinzbewohner das latinische Recht (Bürgerrecht ohne Wahlrecht), Ratsherren der Städte auch das volle Bürgerrecht. Die Provinzen wurden so zunehmend romanisiert, aber im Gegenzug gelangten ehemals „Fremde“ in höchste Positionen des Reiches. So waren die flavischen Kaiser noch Italiener, Trajan (98-117) und Hadrian (117-138) waren Spanier, Antoninus Pius (138-161) stammte aus Südfrankreich, Alexander Severus (222-235) aus Syrien. Die Soldatenkaiser des 3. Jahrhunderts kamen vom Balkan, aus Syrien oder Nordafrika.
212 n. Chr. verlieh der Kaiser Antoninus Caracalla grundsätzlich allen freien Einwohnern des Reiches das Bürgerrecht (constitutio Antoniniana) . Ausgenommen waren nur die dediticii . Wer damit gemeint war, ist nicht genau zu sagen. Es waren wohl nicht die peregrini dediticii ( Rn. 76), sondern gewisse zu schweren Kriminalstrafen verurteilte Personen. Caracalla handelte nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern um die Bürger-(Kopf-)Steuer von mehr Steuerpflichtigen einziehen zu können. Mit dieser constitutio Antoniniana entstand das später unter den Schlagworten Reichsrecht und Volksrecht diskutierte Problem. Denn natürlich gebrauchten die Neubürger nun nicht auf einmal das ihnen oft fremde römische Recht, sondern blieben mehr oder weniger bei ihrem vertrauten Heimatrecht. Das gilt vor allem für den kulturell eigenständig (hellenistisch) gebliebenen Osten des Reiches, insbesondere für Ägypten mit seiner ausgeprägten Rechts- und Verwaltungstradition.
144
Die wirtschaftliche Entwicklung verlief zunächst günstig, wobei natürlich nicht übersehen werden darf, dass die Masse der Menschen nach heutigen Maßstäben recht kümmerlich lebte, oft nur am Rande des Existenzminimums. Der Zustrom neuer Sklaven verringerte sich. Deshalb ging man in der Landwirtschaft zunehmend zum Pachtsystem über. Den Pächtern (coloni) wurde teilweise schon im späten Prinzipat verboten, ihre Pachtstelle zu verlassen. So bereitete sich die im Dominat und germanischen Recht übliche Bindung an die Scholle vor.
Die damaligen Produktionsmöglichkeiten konnten die Bedürfnisse des Militär- und Beamtenapparates auf die Dauer nicht voll befriedigen. Das republikanische System der Steuerverpachtung wurde zunehmend durch staatliche Eintreibung ersetzt. Zwangsmaßnahmen sollten die Erträge sichern, beschleunigten aber im Ergebnis nur den Niedergang der Wirtschaft. So wurden die zunächst freiwilligen Zusammenschlüsse (collegia) der Gewerbetreibenden (Kaufleute, Handwerker) gegen Ende des Prinzipats zunehmend zu Zwangskorporationen, in denen die Mitgliedschaft sogar vererblich war. Söhne waren also gezwungen, den Beruf des Vaters fortzuführen. Die Korporation haftete kollektiv für die von ihr zu erbringenden Leistungen. Die Ratsherren der Gemeinden wurden mit ihren Privatvermögen für das von der Gemeinde geschuldete Steueraufkommen verantwortlich gemacht. Auf diese Weise entstand der allgemeine Zwangsstaat des Dominats.
145
Politisch lief das Prinzipat nach der Ermordung des Kaisers Alexander Severus (222-235 n. Chr.) in das Zeitalter der sog. Soldatenkaiser aus. Es handelt sich bei diesen Kaisern um militärische Anführer, die von ihren Soldaten zu Herrschern ausgerufen und meistens nur kurze Zeit regierten. Oft wurden sie von ihrer eigenen Soldateska umgebracht, wenn sie nicht im Kriege fielen. Die Soldaten erwarteten von ihnen vor allem Geldspenden und Gelegenheiten zum Beutemachen. Neben der ständigen Erhöhung der Last an Steuern und Zwangsleistungen an den Staat waren die Folgen dieser Zustände Münzverschlechterung und Inflation. Mit der Regierung des Gallienus (260-268) bahnte sich eine Konsolidierung der Verhältnisse in Richtung einer stabilen autokratischen Despotie an. Er trennt die Militär- von der Zivilverwaltung. Aurelian (270-275) ließ die noch heute zum großen Teil erhaltene Stadtmauer um Rom erbauen, ein Anzeichen für die zunehmende militärische Bedrohung selbst der Hauptstadt des Reiches.
146
Obwohl aus der auf volkstümliche Reformen gerichteten Bewegung der Popularen ( Rn. 95 ff) hervorgegangen, führte das Prinzipat niemals, auch nicht in Ansätzen, zu einem demokratischen oder liberalen Gemeinwesen. Das galt für die Masse des Volkes ebenso wie für die höheren Stände. Gerade deren Angehörige mussten stets besorgt sein, sich das Wohlwollen des mehr oder weniger selbstherrlichen princeps zu erhalten. So berichtet Sueton über Augustus, dieser habe, obwohl überhaupt nicht auf Erbschaften erpicht, die Urteile seiner Freunde über ihn in ihren Testamenten genauestens abgewogen und er habe weder seinen Schmerz verborgen, wenn jemand seiner zu knapp, noch seine Freude, wenn jemand dankbar und liebevoll seiner gedacht hatte.[2] Den Angehörigen eines Verstorbenen konnte es nicht gerade förderlich gewesen sein, wenn dem Kaiser im Testament Schmerz statt Freude bereitet worden war.
147
Angesichts der allgemeinen Verhältnisse in der römischen Kaiserzeit überrascht es nicht, dass den Menschen die schon von Haus aus pragmatisch-kühle römische Staatsreligion zunehmend gleichgültig wurde. Die göttliche Verehrung der Kaiser ( Rn. 137), zunächst meistens nach ihrem Tode und später auch zu ihren Lebzeiten, hätte als Integrationsfaktor wirken können, wurde aber von der Mehrzahl der Einwohner des Reiches als äußerliche Pflicht abgetan. Stattdessen wuchs die Neigung zu Kulten, die den emotionalen Bedürfnissen eher Rechnung trugen. Nun herrschte in Rom stets Religionsfreiheit in dem Sinne, dass die Verehrung aller möglichen Gottheiten erlaubt war, solange nur den Staatsgöttern und später den Kaisern die ihnen zukommenden Opfer erbracht wurden.
Читать дальше