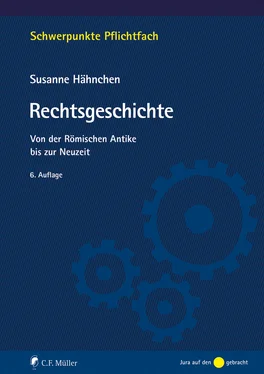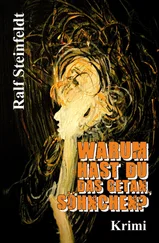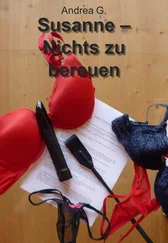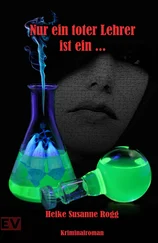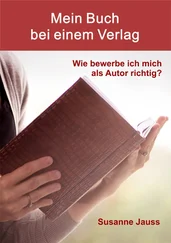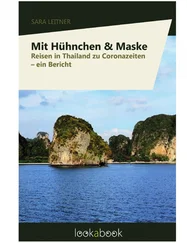a) Allgemeine (Rechts-)Geschichte und römischer Staat
b) Privat- und Prozessrecht
2. Studienbücher
3. Übersetzungen der Quellen
4. Weiterleben des römischen Rechts
III. Deutsche Rechtsgeschichte
1. Allgemeines
2. Privat- und Prozessrecht
3. Verfassungsrecht
4. Übersetzungen der Quellen
§ 1 Einleitung und Grundbegriffe
I. Vom Sinn und Gegenstand der Rechtsgeschichte 1 – 3
II. Historische Hilfswissenschaften – Quellenkunde 4 – 17
1. Gegenständliche Rechtsquellen 5
2. Mündliche Rechtsquellen 6
3. Schriftliche Rechtsquellen 7 – 17
a) Rechtsaufzeichnungen 8
b) Urkunden 9
c) Exkurs: Paläographie 10 – 17
aa) Tontafeln 12
bb) Wachstafeln 13
cc) Papyrus 14
dd) Pergament 15
ee) Papier 16
ff) Bücher 17
III. Recht und Gesetz 18 – 25
1. Weistum 22
2. Willkür, Satzung, Einung 23
3. Rechtsgebot 24
4. Das autoritative Lehrbuch 25
IV. Hinweise zur Anfertigung von Prüfungsarbeiten 26 – 37
1. Literatur zum Thema 27
2. Was ist eine Exegese? 28, 29
3. Die Exegese in der Klausur 30 – 36
4. Besonderheiten der Hausarbeit 37
§ 2 Die Zeit der römischen Könige und die frühe Republik
I. Soziale Strukturen und Aufbau des römischen Staates 38 – 48
II. Rechtsbildung und Juristen 49 – 52
III. Prozessrecht 53 – 60
IV. Privatrecht 61 – 72
1. Person und Familie 61 – 65
2. Erbrecht 66
3. Eigentum 67, 68
4. Schuldrecht 69 – 72
§ 3 Die entwickelte Republik
I. Bis zum Revolutionszeitalter 73 – 76
II. Staatsorganisation in der entwickelten Republik 77 – 94
1. Allgemeines 77, 78
2. Die einzelnen Ämter 79 – 86
3. Der Senat 87
4. Die Volksversammlungen 88 – 94
III. Das letzte Jahrhundert der Republik 95 – 106
IV. Privat- und Prozessrecht 107 – 134
1. Grundlegende Veränderungen 107
2. Gesetzgebung 108, 109
3. Entstehung von Rechtswissenschaft 110 – 116
4. Rechtsbildung durch die Prätoren, insb. Formularprozess 117 – 134
§ 4 Der Prinzipat
I. Rechtliche Grundlagen der Herrschaft des princeps 136 – 147
II. Privat- und Prozessrecht 148 – 191
1. Faktoren der Rechtsbildung 148 – 173
a) Vom Kaiser beeinflusste Gesetzgebung 149 – 153
b) Formularverfahren und Beamtenkognition 154 – 157
c) Kaiserkonstitutionen 158, 159
d) Die klassische Rechtswissenschaft 160 – 173
2. Weitere Institutionen des klassischen Privatrechts 174 – 191
§ 5 Die weitere Entwicklung des antiken römischen Rechts
I. Das Dominat 193 – 215
1. Staat und Stände 193 – 203
2. Nachklassisches Privatrecht 204 – 215
II. Die Kodifikation unter Justinian 216 – 229
1. Die Entstehung des Corpus Iuris Civilis 216 – 226
2. Bearbeitungen und Überlieferung 227 – 229
§ 6 Das Recht der Germanen in früher und fränkischer Zeit
I. Vorfragen 231 – 243
1. „Die Germanen“ 231 – 233
2. Das Kontinuitätsproblem 234 – 236
3. Der politische Rahmen 237 – 239
4. Das Forschungsproblem der Rechtshistoriker 240 – 243
II. Recht in den Germanenreichen 244 – 274
1. Schriftliches Recht 244 – 247
2. Die Volksrechte und Kapitularien 248 – 273
a) Die Leges Visigothorum 248 – 251
b) Die Lex Romana Visigothorum (Breviarium Alarici) 252
c) Die Lex Burgundionum und die Lex Romana Burgundionum 253
d) Das Edictum Theoderici 254
e) Die Lex Salica 255 – 260
f) Kapitularien und Privilegien 261 – 263
g) Die Gesetze der Alemannen und Bayern 264 – 267
h) Die Gesetze der Sachsen, Thüringer und Friesen 268 – 271
i) Die Leges Langobardorum 272, 273
3. Juristische Literatur 274
§ 7 Hohes und spätes Mittelalter
I. Das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“ 276 – 299
1. Reich und Kirche 276 – 287
2. Das Königtum 288 – 297
3. Papst und Kaiser 298, 299
II. Die mittelalterliche Stadt und ihr Recht 300 – 323
1. Urbanisierung und Siedlungstätigkeit 300 – 302
2. Die rechtsschöpferische Leistung des mittelalterlichen deutschen Bürgertums 303 – 317
a) Städtische Freiheit 304
b) Stadtrecht und Stadtrechtsfamilien 305 – 313
c) Die Stadtbücher 314 – 317
3. Die Rechtsstellung der Frau in der mittelalterlichen Stadt318 – 320
4. Zünfte und Gesellen 321 – 323
III. Rechtsbücher 324 – 337
1. Der Sachsenspiegel 324 – 331
2. Tochterquellen, Richtsteige, Glossen 332 – 337
a) Deutschenspiegel 333
b) Schwabenspiegel (Kaiserrecht) 334
c) Frankenspiegel (Kleines Kaiserrecht) 335
d) Richtsteige 336
e) Glossen 337
IV. Mittelalterliche Urkundenlehre 338 – 343
V. Kanonisches Recht344 – 372
1. Aufbau und rechtliche Struktur der römischen Kirche 345 – 356
2. Das Kirchenrecht im engeren Sinne 357 – 372
a) Der Papst als Richter 357 – 359
b) Kirchliche Rechtswissenschaft (Kanonistik) 360 – 368
aa) Das Dekret Gratians 361 – 363
bb) Die kanonistische Literatur 364, 365
cc) Die Beichtjurisprudenz 366 – 368
c) Der weitere Gang der Gesetzgebung (Corpus Iuris Canonici) 369 – 371
d) Kompetenzkonflikte zwischen weltlichen und kirchlichen Gerichten 372
VI. Die Früh-Rezeption des römischen Rechts373 – 407
1. Der Anfang: Bologna 376 – 378
2. Die Glossatoren 379 – 382
3. Die Konsiliatoren 383 – 387
4. Fortentwicklungen des materiellen Rechts 388 – 395
5. Humanistische Jurisprudenz 396 – 401
6. Das Eindringen des gemeinen Rechts in die weltliche Rechtsprechung 402 – 407
VII. Deutsches Privatrecht im Mittelalter 408 – 417
1. Der Gegenstand 408
2. Beispiele 409 – 417
a) Gewere 409 – 415
b) Gesamthand 416, 417
VIII. Gerichtsverfassung und Prozess am Ende des Mittelalters418 – 425
§ 8 Die frühe Neuzeit (1500-1800)
I. Bis zum Westfälischen Frieden427 – 456
1. Die Reichsreformen427 – 430
2. Der Reichstag 431, 432
3. Die Reichskreise 433 – 435
4. Die Reichsstädte 436 – 438
5. Die Gesetzgebung des Reichs 439, 440
6. Die Reformation441 – 444
7. Der Augsburger Religionsfriede 445 – 448
8. Zentralbehörden des Kaisers und des Reichs 449 – 452
9. Der Dreißigjährige Krieg 453
10. Der Westfälische Frieden454 – 456
II. Das Staatskirchentum der frühen Neuzeit 457 – 460
III. Der Territorialstaat 461 – 479
1. Allgemeines 461
2. Ämter und Behörden 462, 463
3. Die Entstehung des öffentlichen Dienstes 464 – 466
4. Die Gesetzgebung der Territorien – die gute Policey 467 – 469
5. Absolutismus 470 – 479
a) Allgemeines 470, 471
b) Der Absolutismus in Brandenburg-Preußen 472 – 474
c) Absolutismus in Österreich 475
d) Absolutismus und Ständestaat in den anderen Territorien 476 – 479
IV. Allgemeines Rechtsdenken und Privatrechtsgeschichte 480 – 520
1. Praktische Rezeption und Usus modernus 480 – 486
2. Naturrecht 487 – 497
3. Naturrechtliche Kodifikationen 498 – 520
a) Der Codex Maximilianeus 499
b) Das preußische Allgemeine Landrecht 500 – 517
c) Das österreichische ABGB 518 – 520
V. Zäsur: Die Französische Revolution521 – 540
1. Die Ausgangslage 522 – 524
2. Der Ablauf der Revolution 525 – 528
3. Die Verfassungen 529 – 535
a) Konstitutionelle Monarchie 530, 531
b) Die demokratische Verfassung 532
c) Die Direktoralverfassung 533
d) Die Konsulatsverfassung 534, 535
Читать дальше