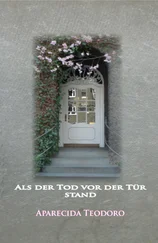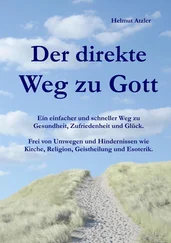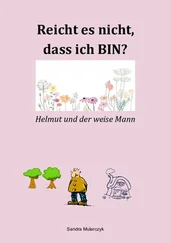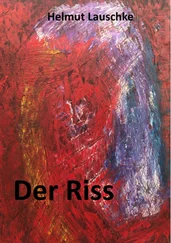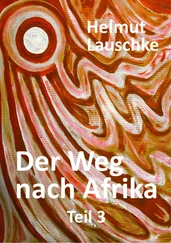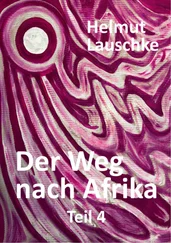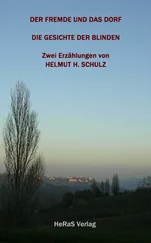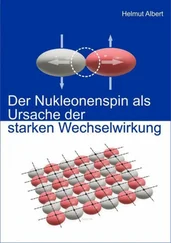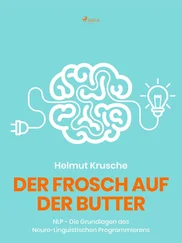Prophylaxe und Prävention sind in die Ordnungsvorstellungen aller Heilkunden eingebunden. Diese beziehen sich auf die angenommenen »Kräfte« und »Energien« der Lebensmittel, deren saisonale Bedeutungen sowie ihre Kühlung oder Erwärmung, Befeuchtung oder Trocknung des Körpers nicht zuletzt auf das gesunde Mischungsverhältnis bzw. Gleichgewicht der Nahrungsmittel. Dabei ergeben sich teilweise Überschneidungen, aber auch Unterschiede zwischen den westöstlichen Heilkunden. Heute werden diese Unterschiede in populär-globalisierten Gesundheits- und Ernährungsratgebern oft ausgeblendet.
Gesunde Ernährung und Nahrungsmittel als Unterstützung von Heilungsprozessen haben eine wichtige Bedeutung. Die moderne Ernährungswissenschaft und deren medizinische Anwendungen haben sich oft auf biochemische Analysen von Nähr- und Wirkstoffen sowie deren pharmakologischen Wirkweisen beschränkt. Ihre Ratschläge beziehen sich darauf, welche Menge und Dosis für den allgemeinen Organismus ausreichend und gut ist, losgelöst von den individuellen Besonderheiten der Menschen. Wissenschaftliche Daten können die Prüfung des individuellen Bedarfs und der persönlichen Bedürfnisse nicht ersetzen. Alternative, naturkundliche oder ökologische Heilmethoden können manche Lücke im Umgang mit Nahrungsmitteln schließen. Oft neigen sie jedoch auch zu ideologischen Verkürzungen, und manche machen es sich mit dem Slogan »Essen Sie sich gesund« zu einfach.
Lebensmittel sind mehr als der Treibstoff zum Überleben, auch wenn dies angesichts der großen Verbreitung von Fast Food »to go« immer häufiger diesen Eindruck vermittelt. Neben der wissenschaftlichen Quantifizierung von Nährstoffen bleiben Qualitäten wie »genießen können« und »Genuss« wichtige Bestandteile der Wirkweisen von Nahrung. Bewusst genießen zu wollen, zu können und zu dürfen sind ein persönlicher Ausdruck von Selbstliebe, Selbstsorge und Selbstverantwortung. Wie viel oder wie wenig, wie üppig oder wie bescheiden das zu Genießende jeweils ist, diese Frage wird individuell beantwortet. Es gilt, die guten Gelegenheiten zu genießen und »auszukosten«. In diesem Wort steckt die zeitliche Begrenzung jedes Vergnügens.
Genuss steht schon seit der Antike, vor allem aber seit dem christlichen Mittelalter, im Verdacht von Völlerei, Exzess, Sünde, Hemmungs- oder Schamlosigkeit. Statt über das Genießen zu sprechen, werden Schattenbilder von Genusssucht, ausufernden Gelüsten oder missbrauchten Genussmitteln an die Wand geworfen.
Auch heute kennen wir die Ambivalenz der Bezeichnung »Genussmensch«. Wir meinen damit einerseits Lebenskünstler oder Feinschmecker, aber auch Lebemenschen oder hemmungslose Genießer. Letztere überziehen maßlos, können kaum einer Versuchung widerstehen, sind süchtig nach Genuss, kennen wenig Grenzen, schlagen sich den Bauch voll, geben sich die Kante oder fallen gar über alles her.
Genießen bringt die Herausforderung mit sich, die Balance zu finden »zwischen Hingabe an die eigenen Bedürfnisse und der Fähigkeit, diese kontrollieren zu können« (Eva-Maria Endress). Es bietet sich uns vieles an, in dessen Genuss wir kommen können – Lebensfreude, Heiterkeit, Vergnügen, Spaß, Wohlbehagen, Leidenschaft, Lust, Hingabe, Seligkeit, Schönheiten der Landschaft, Delikatessen, Leckereien, Spezialitäten, Muße, Feierabend, Stille, Urlaub, Vertrauen, eine gute Ausbildung, Respekt, einen guten Ruf –, aber auch billiges Amüsement, Ausschweifungen, Gelage, Fressen, Zügellosigkeit. Letztere Formen des Genusses haben einen »schlechten Beigeschmack«. Es gilt deshalb, nicht auf den »falschen Geschmack zu kommen«, manches »mit Vorsicht genießen«, und einiges erweist sich auch als »ungenießbar«. Auch angesichts des gewünschten Konsumrauschs sollten wir uns unsere gesunde Genussfähigkeit nicht nehmen lassen, sondern diese verteidigen und pflegen.
RIECHEN –
Immer der Nase nach
Der kleine Gott der Welt (…)
in jeden Quark begräbt er seine Nase.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust I
»Das hab ich doch nicht riechen können«, will sagen: nicht ahnen können – Riechen wird mit etwas in Verbindung gebracht, das mich plötzlich anfliegt, vermuten, vorhersehen, wähnen, wittern, befürchten oder argwöhnen lässt. Manchen Menschen wird »ein guter Riecher« nachgesagt, besonders dann, wenn ihre Vermutungen sich bewahrheiten.
Bereits nach dem Aufstehen, wenn wir noch nicht ganz wach sind, beginnt die alltägliche Offensive von Aromastoffen und Geruchsverstärkern, um uns mit angenehmem Geruch und Geschmack zu beglücken. Mithilfe von Zahnpasta, Seife, Rasierschaum, Shampoo, Deo (lat. »desodorant«, Entriecher) und Gesichtscreme rücken wir unseren Eigengerüchen der Nacht auf den Leib. Frisch gewaschen, beduftet mit Menthol, Limette, Olive, Iris, Alkoholextrakten usw. starten wir in den neuen Tag. Auch die Wäsche ist sauber und dezent mit Duftstoffen versetzt, damit man den aufdringlichen Geruch der in Waschmitteln verwendeten Tenside (seifenähnliche Substanzen aus tierischen Fettsäuren) nicht riecht. Schließlich duftet der Kaffee. Wer weiß schon, dass sich dessen Duft aus ca. 800 Aromen zusammensetzt? Je nach Anbaugebiet und Röstverfahren repräsentiert Kaffee eine breite Duftpalette.
Auf dem Weg zur Arbeit mischen sich unsere Düfte mit denen unserer Umgebung und Mitmenschen. Mit jedem unserer täglich etwa 23 000 Atemzüge nehmen wir Duftbotschaften auf und geben solche ab. Unser Geruchssinn hilft uns, uns in der Welt der chemischen Reize zurechtzufinden. Wir können mit seiner Hilfe Gefahrenquellen in der Luft wahrnehmen (giftige Gase usw.), und er bietet uns Schutz vor verdorbenen Lebensmitteln.
Individuelle Geruchsgeschichten
Jeder von uns hat seinen ganz persönlichen Geruch und seine eigene »Geruchsgeschichte«. Viele Gerüche bleiben uns unbewusst in Erinnerung. Ich erinnere mich zum Beispiel lebhaft an die Intensität des Weihrauchs während meiner Messdienerzeit oder an den Holzgeruch frisch geschnittener Bretter im benachbarten Sägewerk. Der penetrante ölige Gestank von Carbolineum, das in der Nachkriegszeit zur Pflege der Holzbohlen meiner Volksschule verwendet wurde, holte mich viele Jahre später in den Baracken der DDR-Grenzkontrollen wieder ein. In Erinnerung geblieben sind intime Gerüche aus Liebesnächten, der wunderbare Geruch der Haare und Köpfe meiner Kinder als Babys, die Ausdünstungen von voll geschissenen Windeln und frisch gecremten Kinderpopos. Später, in der Pubertät, hinterließen die Kinder öfters memorable Schwaden von Deodorants vor ihren Partybesuchen.
Reisen in fremde Länder hinterließen exotische Geruchsspuren. Lavendelduft der Provence, Oleander, Orangenduft und Gewürzsträucher im griechischen Frühling, der Geruch von Curry und Patchuli in Indien, frische Baguettes in Frankreich oder der Duft von riesigen Schinken, die in toskanischen Metzgereien zum Trocknen aufgehängt waren, sind nur einige Beispiele. Wenn ich Blätter vom Oreganostrauch im Garten zwischen meinen Fingern zerreibe, dann ruft deren Duft in mir unmittelbar Bilder von Spaziergängen auf den Hügeln von Kreta hervor.
Aus den Jahren meiner Arbeit in Krankenhäusern bleiben Geruchserinnerungen an viele Liter von Händedesinfektionsmitteln sowie an das liebevoll verteilte Rosenöldestillat, das viele ältere türkische Patientinnen mir auf die Hände tropften, bevor ich sie untersuchen durfte. Nicht zuletzt erinnere ich mich an die fauligen Gerüche der bakterieninfizierter Wunden beim Verbandswechsel oder an den Geruch von Blut und Fruchtwasser während der Zeiten im Kreißsaal. In den vielen Tausenden von Therapiesitzungen umgaben mich Parfümdüfte und Deodorants meiner PatientInnen ebenso wie häufig der Geruch von Angstschweiß und anderen Körpergerüche.
Читать дальше