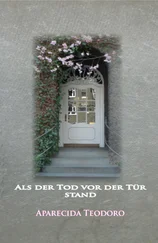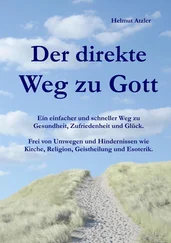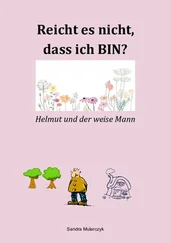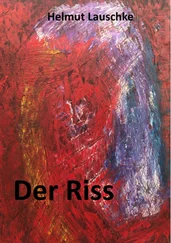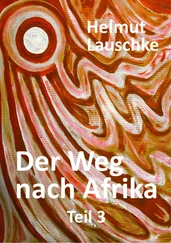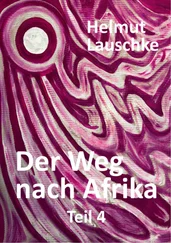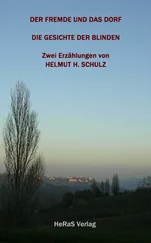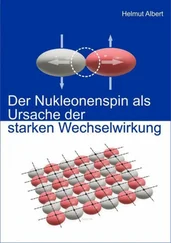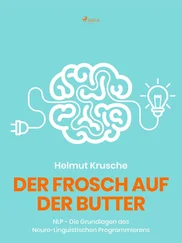Nicht nur im religiösen Kontext, sondern auch im ethnischen und nationalen Zusammenhang spielt Essen eine besondere Rolle. Wir sprechen von »Nationalgerichten« und »Nationalgetränken«. Gerade in globalisierten Gesellschaften gibt es viele ethnisch bezogene Traditionen zur Pflege von Esstraditionen und Esskultur. Bisweilen werden damit Heimatorte oder Regionen, in denen man gewohnt hat, bewusst erinnert. Im Rahmen des Tourismus ist es wichtig, die Authentizität der regionalen Küche hervorzuheben.

Immer häufiger verzehren Menschen ihr Essen ohne Pausen vor dem Bildschirm.
Auch im Familienkontext werden kulturelle und sozial angeeignete Rituale von Essen und Geschmack betont. Die gemeinsamen Mahlzeiten der Familie sind wichtige Alltagsrituale: »Lasst es euch schmecken«, »gesegnete Mahlzeit«, »haut rein«. Gemeinsame Mahlzeiten im Familienkontext dienen auch zur Aneignung von Tischsitten und Essverhalten. Händewaschen, warten bis alle am Tisch sind, Essen unter den am Tisch sitzenden Familienmitgliedern aufteilen, das Essen nicht herunterschlingen, nicht schmatzen, nicht beim Essen reden, nicht mit den Fingern essen oder zu deutlich das Essen mit der Nase prüfen.
Die ursprüngliche private Weitergabe von Kochgeheimnissen und Kochrezepten ist inzwischen immer mehr an Kochbücher, Food-Blogs oder Fernsehkochshows delegiert worden. Die sozialen Veränderungen bedingen heute, dass Kinder ihr Frühstück in den Kitas oder in der Schule zu sich nehmen. Gemeinsame Mittagsmahlzeiten werden durch Kantinenessen und Fast Food zwischendurch ersetzt. Für viele Menschen ist Essen im Arbeitsalltag zum »Stressfaktor« geworden. Manche verzichten häufiger vom Frühstück bis zum Abendessen auf Nahrungsaufnahme oder stopfen sich vor dem Bildschirm rasch etwas in den Mund. Diese unregelmäßige Nahrungsaufnahme und die damit verbundene biologische Veränderung der Verdauung haben erheblichen Einfluss auf die zunehmenden Essstörungen, etwa in Form von Übergewicht.
Vom lokalen Anbau bis zur industriellen Produktion von Nahrungsmitteln
In den letzten zweihundert Jahren hat die Nahrungsmittelproduktion erhebliche Veränderungen erfahren. Maschinell unterstützter Anbau, Konservierung, Transport, Verpackung, Vermarktung und industrielle Produktion von Nahrungsmitteln haben in enormem Tempo zugenommen. Während zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Mehrzahl der ärmeren städtischen Bevölkerung ihren Kohlenhydratbedarf mit Getreide und Mehl, Bohnen und Erbsen und nur wenigen tierischen Nahrungsmitteln deckte, herrschte auf dem Land weitgehend Selbstversorgung. Die ärmeren Schichten in den Städten mussten damals drei Viertel ihres Lohns für Nahrungsmittel aufbringen.
Mitte des 19. Jahrhunderts begann die systematische Nutzung der bis dahin eher gering geschätzten Kartoffeln. Die Zunahme von Schiffsverkehr und Eisenbahn sowie später des Transports durch Autos ermöglichten eine neue Logistik der Nahrungsmittelverteilung. Durch die Entwicklung der Lebensmittelchemie gelang in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die industrielle Produktion von Fleischextrakt, Tütensuppen, Keksen oder Backpulver. Es entwickelten sich neue Möglichkeiten der Konservierung und Haltbarmachung. Ab den 1930er-Jahren waren Konserven in größerem Maße produzierbar. Das Kochgeschirr wurde ab den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts zusehends aus Aluminium hergestellt, und der Elektroherd ersetzte immer mehr den offenen Feuerherd. Elektrische Küchengeräte kamen ab Mitte der 50er-Jahre in größerem Maße in die Haushalte. Die Haltung von Lebensmitteln wurde in den 70er-Jahren explosionsartig durch die breite Einführung von Kühlschränken möglich. Verpackungsmaterialien in Form von Kunststoffen kamen zur Sicherung von Frische, Hygiene, Geruch und Geschmack in den Handel. Die industrielle Produktion übernahm beim sogenannten Convenience-Food auch das Säubern, Schälen, Häuten, Entkernen, Entgräten, Mischen, Würzen und Portionieren der Nahrungsmittel. Aus den USA breitete sich eine Welle des Fast Food in andere Länder aus. Als Reaktion darauf entwickelte sich ab den 1990er-Jahren eine größere Gegenbewegung zur Förderung von regionaler, biologischer, organischer und ökologischer Kost. Diese neuen, vor allen Dingen gesundheitsbezogenen Ernährungstrends wurden schrittweise von staatlichen Behörden aufgenommen. Entsprechende Veränderungen in der Zubereitung bereiteten der Nahrungsmittelindustrie erhebliche Schwierigkeiten.
Wo früher noch Kontakt mit dem Anbau und der saisonalen Verfügbarkeit und Zubereitung von Lebensmitteln bestand, geht heute durch die Globalisierung jeglicher sinnliche Kontakt zur Nahrungsmittelherstellung und -verarbeitung für immer mehr Menschen verloren. Lebensmittel gleichen für viele Menschen einem »energetischen Treibstoff«, der durch Supermärkte geliefert wird.
Lasst es euch schmecken
Diese verkürzt dargestellten Verbindungen zwischen Biologie, Kultur und Gesellschaft mit dem Geschmackssinn machen deutlich, dass Geschmack mehr ist als eine Frage der Sinnesphysiologie. Der Gastrosoph Harald Lemke hat den Begriff »essthetisch« für den seiner Meinung nach »organlosen Sinn für Geschmack« verwendet. Er nimmt Bezug auf den Geschmacksphilosophen Brillat-Savarin und dessen Aussage: »Die Geschmäcker sind unzählig, denn jeder lösliche Körper besitzt einen besonderen Geschmack, der keinem anderen ganz ähnlich ist.« Die Frage, welche und wie viele Geschmäcker wir wahrnehmen, hängt davon ab, mit welcher Aufmerksamkeit, mit welchen Erwartungen, mit wie viel Zeit und Genuss wir uns zu essen erlauben. Aus der Mischung von Sinnesempfindungen entsteht das, was durch das Wort »munden« vielleicht am besten ausgedrückt wird. »Munden« deutet darauf hin, dass die Augen mitessen, dass es ein Ohrenschmaus ist, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, dass wir uns »vollmundig« von dem überraschen lassen, was sich im Mund an Köstlichkeiten entfaltet. Vielleicht gehört zu einem vollmundigen Essen bisweilen auch etwas weniger Sittsamkeit, sodass Schlürfen und Schmatzen oder ausgeprägte Bewegungen von Mund und Gesicht nicht zu schnell der guten Sitte zum Opfer fallen. Das genüssliche Essen mit Freunden, Familie, Kollegen, ja selbst mit Fremden könnte wieder mehr zum Erlebnis werden, das Gemeinschaft spendet. Wer etwas miteinander klären und lösen möchte, der wird »zu Tisch gebeten«, und man setzt sich gemeinsam »an einen Tisch«. Vielleicht können gemeinsam genossene Mahlzeiten sogar dazu beitragen, dass wir uns weniger bekriegen und mehr friedliches Miteinander finden.
Maßhalten und bewusst genießen
»Es ist also nötig, sich nach einem bestimmten Maß umzusehen. Als Maß aber, auf das man sich beziehen könnte, um Sicherheit über die Quantität und Qualität der Speisen zu gewinnen, wird man weder ein Gewicht noch eine Zahl noch etwas anderes finden, sondern nur das Gefühl des Körpers«, schrieb schon Hippokrates.
Ursprünglich prüft der Geschmackssinn die Genießbarkeit einer Nahrung. Wenn diese für gut befunden wird, dann kann sie zum Essen verführen. Essen soll den Hunger stillen und uns neue Lebenskräfte einverleiben. Ernährung und Lebensmittel gehören (neben Leibesübung und Ruhe, Klima, Sexualität, u.a.) zu den unverzichtbaren Grundelementen der gesundheitlichen Ordnungsvorstellungen (Diäten). Der Begriff »Diät« leitet sich von griech. »dieita«, Lebensweise, Lebenskunst ab. In der Tradition des Hippokrates wurde erstmals die Idee vertreten, dass nicht nur die Götter über Wohl und Wehe entscheiden, sondern dass die Menschen selber, durch ihre Lebensführung, mitbestimmen, wer Herr/Frau in ihren Körpern ist. Dementsprechend wichtig sei es im einfühlsamen Kontakt mit dem Körper zu sein und mit ihm das notwendige Maß für Tun und Lassen zu finden.
Читать дальше