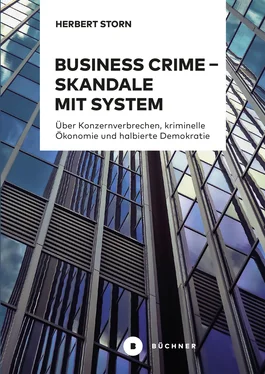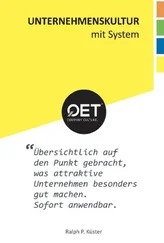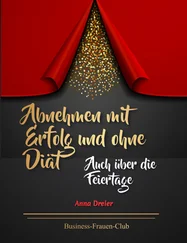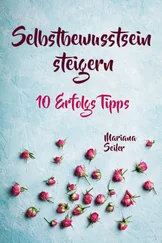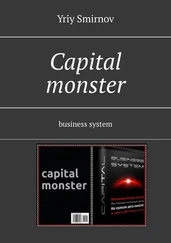Daraufhin wurde 2010 von K+S die ›ernsthafte Prüfung‹ des Baus einer Rohrfernleitung zur Nordsee zur Entsorgung der Kaliendlaugen angekündigt, die aber nicht in Angriff genommen wurde.
Der Versuch, mit einem neuen Rechtsgutachten eine neue Versenkerlaubnis zu erreichen, scheiterte zunächst an dem HLNUG, das in einer umfangreichen Stellungnahme vom 10.07.2014 darlegte, dass eine Erhöhung der Förderung einen Anstieg der Chloridwerte jenseits des Grenzwerts mit Besorgnis erfüllen würde.
Durch Einwirkungen aus den Reihen des Regierungspräsidiums Kassel und des hessischen Umweltministeriums zwischen September 2014 und Januar 2015 habe sich das HLNUG schließlich im Januar 2015 zu einer Protokollnotiz bereit erklärt, das Wort ›Besorgnis‹ in Bezug auf die dort bewerteten Trinkwassergewinnungsanlagen nicht im wasserrechtlichen Sinn verwendet zu haben. Dadurch wurde es dem Regierungspräsidium Kassel wiederum ermöglicht, auch die weiteren Verwaltungsentscheidungen zur Laugenversenkung mit der These zu begründen, eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung sei ausgeschlossen, da auch nach Ansicht des HLNUG in Bezug auf die bestehenden Gewinnungsanlagen keine Besorgnis bestünde.
Die letzten Versenkerlaubnisse vom 17.12.2015 und vom 23.12.2016 basieren entscheidend auf dem sogenannten 4-Phasenplan , den die hessische Umweltministerin und der Vorstandsvorsitzende der K+S AG im September 2014 unterzeichneten und der Öffentlichkeit präsentierten. Dieser sieht unter anderem eine Fortsetzung der Laugenversenkung bis Ende 2021 vor, schreibt aber auch deren endgültiges Ende zu diesem Termin fest. Weiterhin regelt der Plan eine Zeitschiene an Maßnahmen und Investitionen bis zu diesem Zeitpunkt, die bei Fortführung des Betriebs der Kaliwerke den Entsorgungsweg Versenkung ab Ende 2021 entbehrlich machen sollen.
Aber auch dieser 4-Phasenplan basierte auf dem bis dahin benutzten 3-D-Grundwassermodell, das die gesetzten Ansprüche nicht erfüllte, kritisiert die Staatsanwaltschaft.
Dennoch erließ das Regierungspräsidium Kassel am 17.12.2015 die Übergangserlaubnis und begründete das Fehlen einer Besorgnis gemäß § 48 WHG allein mit dem modifizierten Kurzgutachten des Behördengutachters. Die dem entgegenstehenden Passagen in den Stellungnahmen des HLNUG und des Thüringer Landesverwaltungsamts wurden in der Bescheidbegründung hingegen übergangen.
Dass der Staatsanwalt trotz alledem zu dem Schluss kommt, dass ein Strafverfahren nicht eingeleitet werden könne, bestätigt die Feststellung von Hans See zu Beginn dieses Buches, dass mit Einzelgesetzen einem solchen Zusammenwirken von Konzernen und Behörden nicht beizukommen ist.
Die Begründung der Staatsanwaltschaft für die Einstellung des Verfahrens fußt dann auch zum einen darauf, dass das Umweltstrafrecht ein Individualstrafrecht sei, und Rechtswidrigkeit nicht ausreiche. 14
Zudem läuft der strafrechtliche Begriff der Drohung ins Leere, weil die Drohung wesentlich darin bestehe, dass der Druck mit dem Hinweis auf gefährdete Arbeitsplätze erzeugt wird. Dieses Muster wird uns immer wieder begegnen.
Die oben dargelegten Vorgänge erinnern sehr stark an den Wirecard-Betrug, bei welchem Wirecard gegen Privatpersonen und gegen eine Zeitung per Anzeige vorging, um sie einzuschüchtern. Und hinterher stellte sich heraus, dass die Kritik Recht hatte.
Die Aufklärung berührt auch sehr stark das Selbstverständnis der Grünen, nicht zuletzt, weil das involvierte hessische Umweltministerium gegenwärtig und seit längerer Zeit von prominenten Grünen geleitet wird und wurde: zurzeit von Priska Hinz (seit Januar 2014, aber auch schon unter Eichel, SPD von März 1998 bis April 1999). Außerdem war Joschka Fischer erster grüner Umweltminister unter Holger Börner, SPD, von 1984 bis 1987 und dann wieder unter Hans Eichel von April 1991 bis Oktober 1994. Die Grünen haben das hessische Umweltministerium seit den 80er Jahren bis heute insgesamt rund 17 Jahre geleitet. Daraus lassen sich schon Rückschlüsse auf die Durchsetzungsfähigkeit von Umweltschutzbelangen einer grünen Partei ableiten. Die positiven Seiten sind in der Regel bekannt, weil in der Politik Erfolge zählen. Dazu gehört in Hessen mit Sicherheit die Schließung der Hanauer Nuklearbetriebe.
Genauso wichtig aber ist die ehrliche Aufarbeitung von Misserfolgen und Fehlern!
Und zu diesen gehört eine sorgfältige Analyse der Durchsetzungsbedingungen zwischen Staat oder Kommunen und Unternehmen, besonders, wenn sie, wie K+S, in ihrem Tätigkeitsfeld weltweite Spitzenpositionen innehaben, also ›global player‹ sind.
Und für diese gehörte ›Ökodumping‹ immer schon zum Geschäftsmodell. Während die Gewinne zu den Aktionären fließen, werden die Kosten für die Schäden vergesellschaftet. Und zwar solange, wie es nur irgend geht.
Geldwäsche und kriminelle Immobilienwirtschaft – ein etwas anderer Schadensvergleich
Der EU-Abgeordnete der Grünen und Finanzexperte Sven Giegold geht nach seriösen Schätzungen von Geldwäsche im Umfang von rund 100 Milliarden Euro jährlich allein in Deutschland aus.
Dass Geldwäsche über Restaurants läuft, die von kriminellen Organisationen dafür benutzt werden, ist seit Jahrzehnten im öffentlichen Bewusstsein. Weniger bekannt ist die Anlage krimineller Gelder im Immobiliensektor, insbesondere seit der Phase der Nullzinspolitik, durch die Immobilien wegen der enormen Nachfrage nochmals im Wert gesteigert worden sind.
»Der deutsche Immobiliensektor wird zunehmend zum Ziel milliardenschwerer Geldwäsche. Am 7. Dezember 2018 wurden in Berlin die Ergebnisse einer von Transparency International herausgegebenen und von Markus Henn, Finanzexperte der Entwicklungsorganisation WEED , verfassten Studie vorgestellt. Danach werden verstärkt aus dem Ausland stammende Gelder, deren Herkunft unklar ist bzw. auf kriminelle Handlungen zurückgeht, im deutschen Immobilienmarkt investiert. Allein im Jahr 2017 sollen es über 30 Milliarden Euro gewesen sein, sodass 15 bis 30 Prozent aller kriminellen Gelder inzwischen in den Erwerb von Immobilien fließen.« (BIG Business Crime Extra 2019)
Im selben und letzten Printheft von BIG Business Crime nimmt Joachim Maiworm diesen Faden auf, kommt aber zu einer bemerkenswerten Schlussfolgerung, die schon im zweiten Teil der Überschrift angedeutet ist: Geldwäsche im Immobiliensektor – Staat und Wirtschaft als Koproduzenten der Kriminalität . 15
Die veröffentlichte Meinung lenke mit dem Fokus auf das schmutzige Geld davon ab, dass legale Geschäfte auch im Immobilienbereich weitaus größere gesellschaftliche Schäden anrichteten als kriminelle Aktivitäten.
Dazu gehört, dass letztlich die Mieter die Spekulationskosten bezahlen, so sie denn überhaupt noch angemessenen Wohnraum bekommen können. Von daher erklärt sich auch das erfolgreiche Volksbegehren in Berlin vom 26.9.2021, mit dem der Berliner Senat aufgefordert wird, »alle Maßnahmen einzuleiten«, die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind, und dazu ein Gesetz zu erarbeiten. 16
Zu den schädlichen Folgen gehört aber auch, dass zunehmend Grundstücke für öffentlichen Bedarf wie Schulen, Kitas oder auch öffentlich geförderte Wohnungen fehlen.
Wenn aber legale Geschäfte größere Schäden anrichten als kriminelle, dann sollte die gesamte Öffentlichkeit eines Gemeinwesens nicht nur hellhörig werden, sondern gewaltig Alarm schlagen!
Leider ist das Gegenteil der Fall: Mit der Ethnisierung der Kriminalität werde von der Mitwirkung des deutschen Staates abgelenkt, sagt Maiworm. »Die Geldwäsche ist mit den Geschäftsinteressen der legalen Wirtschaft so eng verwoben, dass sich die Grauzone zwischen legalem und illegalem wirtschaftlichem Handeln stetig vergrößert und eine Grenzziehung kaum möglich erscheint.«
Читать дальше