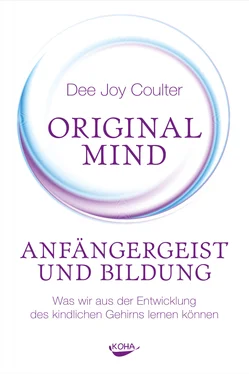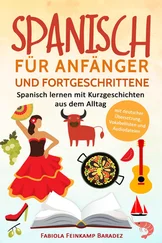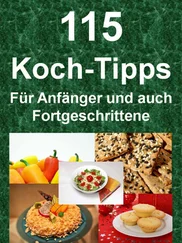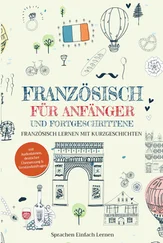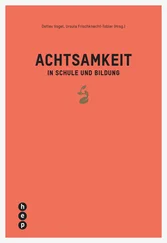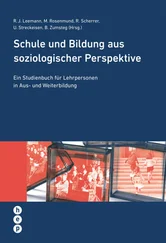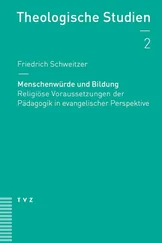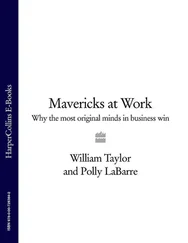ZHANGI ZHINGI
1993 lehrte ich bereits seit zehn Jahren an der Naropa Universität in Boulder, Colorado. Diese buddhistisch inspirierte Universität wurde von Chögyam Trungpa Rinpoche gegründet, einem tibetischen Mönch, der eine Hauptrolle dabei spielte, den Buddhismus in den Westen zu bringen. Es begann sich ein Interesse für die Zusammenhänge zwischen buddhistischem Gedankengut und neurologischen Erkenntnissen zu entwickeln. Die in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfindenden Mind and Life-Dialoge zwischen Wissenschaftlern, Mönchen und seiner Heiligkeit des Dalai Lama hatten einen jungen tibetischen Mönch für einen kurzen Besuch nach Boulder geführt. Er wollte etwas über den menschlichen Geist wissen, und da ich zu dieser Zeit den besten neurologischen Hintergrund hatte, wurde ich zu einem Gespräch mit ihm gebeten.
Nach einer kurzen Begrüßung durch seinen Übersetzer wurde ich aufgefordert, mich neben ihn zu setzen, damit er mir seine Frage stellen konnte. Er sprach auf Tibetisch, wandte den Kopf ab und schaute dabei quer durch den leeren Raum auf ein imaginäres Objekt. »Ich schaue.« Er hielt kurz inne und fuhr dann fort: »Ich sehe eine Blume. Erstes Mal. Was passiert?« Ich begann zu erklären, wie die Information von den Augen zum visuellen Cortex übertragen wird, doch als der Übersetzer meine Worte weitergab, wurde schnell deutlich, dass es ihm in seiner Frage nicht darum ging.
Der Mönch unterbrach ihn, schüttelte den Kopf und versuchte es aufs Neue. »Ich schaue.« Pause. »Ich sehe eine Blume. Erstes Mal.« Er bewegte den Kopf wie zuvor, doch dieses Mal fuhr er fort, indem er den Kopf nochmal in derselben Weise bewegte und wiederholte: »Ich schaue« Pause. »Ich sehe eine Blume. Erstes Mal. Was passiert?« Ich war verblüfft! (Ich werde noch auf die verschiedenen Dinge eingehen, die mir in diesem Augenblick klar wurden, aber ich will zunächst die Geschichte fertig erzählen.)
Er erklärte mir, dass, wenn er auf eine Blume schaut, sie zuerst nicht sieht, und sie erst dann Form annimmt. Er schien sich dessen bewusst zu sein, dass sein Geist aus den Lichtwellen, die von der Blume ausgehen, ein Signal bildet. In der Wissenschaft nennen wir das feature binding . (= Die Integration von Einzelmerkmalen eines wahrgenommenen Objekts zu einer kohärenten Gestalt.) Jeder von uns tut es, aber es passiert so schnell, dass uns in der Regel dieser Prozess überhaupt nicht bewusst ist. Ich dachte, er würde vielleicht wissen wollen, wie dieser Strukturierungsprozess erfolgt, also erklärte ich, wie das Gehirn diese Signale aus der allgemeinen neurologischen Reizflut herausfiltert. Die Zellen plappern sozusagen ständig vor sich hin, doch wenn sich eine Gruppe von ihnen in Reaktion auf einen bestimmten Reiz zusammenschließt, entsteht ein Signal, welches diesen »Hintergrundlärm« übertönt. Dieses Signal besteht aus kohärenten Informationen, es bildet ein bestimmtes Wellenmuster, welches sich von dem Geplapper abhebt. Dieses neurologische »Geplapper« bildet eine Art chaotischen Hintergrund, vor dem selbst das zarteste kohärente Signal deutlich herausragt.
Diese Erklärung gefiel ihm offensichtlich. Er schaute mich aufmerksam an, während der Übersetzer ihm meine Worte vermittelte. Doch bei dem Wort chaotisch blieb der Übersetzer stecken. Es schien kein tibetisches Wort dafür zu geben. Dem Mönch war klar, dass dieses Wort von zentraler Bedeutung war. Nach einer Weile sagte er erfreut: »Ah, Zhangi Zhingi, Zhangi Zhingi.«
»Ja«, antwortete ich, in dem festen Glauben, dass Worte mit so vielen Z bestimmt irgendwie das Chaos beschreiben. Damit war das Interview zu Ende. Man dankte mir und verabschiedete mich.
Vier Jahre später saß ich bei einem Retreat der Naropa Fakultät neben Sarah Harding, einer hervorragenden Gelehrten und Kennerin der tibetischen Sprache, und erzählte ihr diese Geschichte. »Was bedeutet ›Zhangi, Zhingi‹?«, fragte ich sie.
»Es bedeutet ›verfilztes Haar‹«, erklärte sie.
Was für ein passendes Bild für Chaos! Und was für eine wunderbare Frage, die er gestellt hatte! An ihr wird deutlich, wie sehr sich sein durch jahrelange Meditation geschulter Geist von den Begrenzungen des westlichen Denkens unterscheidet, die ihm merkwürdig erschienen sein müssen. Der westlich konditionierte Geist lässt gewöhnlich nicht zu, dass sich Bilder auflösen. Er arbeitet hart daran, sich ein verständliches Weltbild aufzubauen, und hängt an dem Wissen und der Fachkenntnis, die er sich erworben hat. So werden die Bilder festgeschrieben, und eine Blume wird beim zweiten Blick automatisch als dieselbe Blume eingeordnet.
Diese Geschichte wirft zwei wichtige Fragen auf. Wenn der Mönch zuerst keine Blume sieht, was sieht er dann, bevor das Bild der Blume auftaucht? Und zum Zweiten: Wie kann er das Bild der Blume auslöschen, um die Blume beim zweiten Mal wieder »zum ersten Mal« zu sehen? Merken Sie sich diese zwei Fragen bitte, während Sie weiterlesen. Sie gehören zu dem Muster, welches ich erkannte, als ich die Frage des Mönches verstanden hatte.
Diese Geschichte beschreibt eine relative hohe geistige Kompetenz. Doch Sie können ganz einfach anfangen, diese Perspektive einzuüben. Unterbrechen Sie ein bis zwei Mal am Tag ihre gewohnten Aktivitäten und verändern Sie Ihren Fokus. Probieren Sie, einen Moment lang einfach das Licht, die Farben und die Bewegungen um sich herum wahrzunehmen, bevor die Stimme in Ihrem Kopf anfängt, das Gesehene zu benennen. Vielleicht denken Sie jetzt, Sie müssten dafür einen Spaziergang in der Natur machen, doch es geht genauso gut im Supermarkt, im Büro oder in Ihrer Wohnung. Diese isolierten Sinneseindrücke bieten sich überall an! Die folgenden Abschnitte werden Ihnen helfen, diese Fähigkeit zurückzugewinnen.
SEHEN WIE EIN SÄUGLING
Betrachte Dinge, wie es ein Säugling tut, ohne Vorwissen … lass diese Sicht in dich einsinken
und erfahre sie ganz und gar,
ohne zu verstehen.
Murshid Fazal Inayat-Khan
bedeutender Sufi-Lehrer, ehemaliger Leiter der internationalen Sufi-Bewegung
Säuglinge sehen die Dinge nicht, wie wir sie kennen, sondern die Bewegungsspuren, die sie hinterlassen. Vor allem biologische Bewegungsspuren sind faszinierend für sie. Woher wir das wissen? Ein paar clevere Forscher haben folgendes geniale Experiment durchgeführt: Sie haben eine Person ganz in Schwarz gekleidet, ihr auch Gesicht und Hände geschwärzt und an den wichtigsten Gelenken – Ellenbogen, Handgelenke, Schultern, Hüften und so weiter – kleine LED-Leuchten befestigt. Dann haben sie gefilmt, wie sich diese Person vor einem schwarzen Hintergrund durch einen abgedunkelten Raum bewegt. Den Film, auf dem nur die Bewegungsspuren der Gelenke zu sehen waren, führten sie Säuglingen vor. Die Babys liebten es offenbar, diesen Film zu sehen, denn sie schauten lange Zeit unverwandt hin. Dann veränderten die Forscher den Film ein wenig, indem sie die Bewegungsspur eines Ellenbogenlichts so veränderten, dass sie unzusammenhängend vor- und zurücksprang. Die Babys waren von diesem Anblick offenkundig verstört und wandten schnell den Blick ab. Der veränderte Film brach mit dem natürlichen Fluss menschlicher Bewegungsspuren. Die Säuglinge konnten das offenbar wahrnehmen, obwohl auf den Bildern kein Mensch zu sehen war. Aus dem Hinschauen oder Abwenden des Blicks ziehen die Forscher Rückschlüsse darüber, was Säuglingen angenehm oder unangenehm ist.
Auch die Reaktion eines Säuglings auf Schönheit hat vielleicht nicht mit dem zu tun, was wir auf einem Bild wahrnehmen. Forscher baten eine Gruppe von College-Studenten, aus je einhundert Fotos von Studentinnen und Studenten jeweils die zehn attraktivsten und die zehn unattraktivsten herauszusuchen. Dann zeigten sie diese Bilder nacheinander einer großen Anzahl von sechs Wochen alten Babys. Bei jenen, die von den Studenten als attraktiv eingestuft worden waren, schauten die Babys lange hin, und bei den unattraktiven wandten sie den Blick ab oder zeigten Anzeichen von Unbehagen. Porträtmaler sagen, der Unterschied zwischen einem als schön und einem als hässlich empfundenen Gesicht sei vor allem eine Frage der Proportionen. Wenn ein Aspekt nur ein wenig verändert wird, kann ein Gesicht plötzlich seine Schönheit verlieren, als ob es eine mathematische Formel oder eine Schablone für »schöne Gesichter« gäbe. Was sahen diese Kinder also? Babys lernen rasch, das Gesicht ihrer Mutter zu erkennen, doch sie brauchen Monate, um andere Gesichter so weit zu fokussieren, dass sie sie erkennen können. Die Kinder in dieser Studie waren dafür noch zu jung, sie haben also keine Gesichter in unserem Sinne gesehen. Ihre Reaktion scheint vielmehr von der Harmonie oder Disharmonie der Proportionen abzuhängen.
Читать дальше